Golloch R. Downsizing bei Verbrennungsmotoren: Ein wirkungsvolles Konzept zur Kraftstoffverbrauchssenkung
Подождите немного. Документ загружается.


4.2 Variabilitäten und Prozesssteuerung 225
wird. Abhilfe kann hier eine Kombination mit Ventilteilhüben schaffen, die zu
höheren Strömungsgeschwindigkeiten führen. Der damit verbundene, leichte An-
stieg der Strömungsverluste wird durch die Verbesserungen im Verbrennungsab-
lauf überkompensiert. Durch das vergleichsweise frühe Schließen des Einlassven-
tils ist bei Beginn der Verbrennung nur eine sehr geringe Ladungsbewegung vor-
handen. Das führt grundsätzlich zu einer schlechten Gemischbildung insbesondere
bei direkteinspritzenden Ottomotoren und erfordert aufgrund der erschwerten
Entflammbarkeit frühe Zündwinkel bzw. höhere Zündenergien. Zur Steigerung
der Ladungsbewegung haben sich Maskierungen im Ventilsitzbereich bewährt, die
beim Einströmen des Frischgases Turbulenzen erzeugen.
Bei aufgeladenen Motoren wird das Verfahren FES auch als Miller-Verfahren
bezeichnet, vergleiche Abschn. 4.1.1. Hierbei sind jedoch höhere Druckverhältnis-
se und damit höhere Verdichterdrehzahlen erforderlich, damit die erforderliche
Ladungsmasse innerhalb der kurzen Einlassventil-Öffnungsdauer eingebracht
werden kann. Die Verdichterarbeit wird daher zum Teil in den vorgelagerten Ver-
dichter verlagert. Der dadurch gesteigerte Leistungsbedarf des Verdichters muss
von der Turbine bereitgestellt werden. Das ist möglich, wenn das Abgas ansonsten
teilweise über ein Wastegate an der Turbine vorbeigeführt wird. Der erhöhte Leis-
tungsbedarf wirkt sich jedoch u.U. nachteilig auf das Ansprechverhalten des Tur-
boladers aus, wenn ein größerer ATL eingesetzt werden muss.
Während die Gastemperaturen durch die frühe Expansion vergleichsweise nied-
rig sind, werden durch das Miller-Verfahren infolge des hohen Ladedruckes – je
nach Lage der Steuerzeit ES – höhere oder niedrigere Zylinderspitzendrücke er-
zeugt. Bei hohen Drehzahlen ist zur Darstellung dieser hohen Ladedrücke folglich
der Verzicht auf ein Abblasen eines Abgasteilstroms möglich. Durch das reduzier-
te Temperaturniveau können die Klopfneigung verringert, das geometrische Ver-
dichtungsverhältnis erhöht und damit höhere Mitteldrücke realisiert werden. In
Verbindung mit den realisierbaren hohen Zylinderspitzendrücken werden höhere
Wirkungsgrade erreicht. Da zudem die Abgastemperatur ebenfalls niedriger aus-
fällt, sinkt der bei hoher Last und Drehzahl erforderliche Anfettungsbedarf, sodass
zusätzliche Kraftstoffverbrauchssenkungen möglich sind [FRI02].
Beim Verfahren SES – auch bezeichnet als Reverse-Miller-Cycle – schließt das
Einlassventil erst während des Kompressionshubes. Je niedriger der Lastpunkt,
desto später schließt das Einlassventil. Die überschüssige Zylinderladung wird
somit in den Ansaugkanal zurückgeschoben und passiert das Einlassventil zwei-
mal, was mit erhöhten Strömungsverlusten verbunden ist, ohne dass dies für eine
intensivere Gemischbildung genutzt werden kann. Bei aufgeladenen Motoren
muss der Kolben zudem gegen den erhöhten Saugrohrdruck arbeiten, sodass die
charakteristische positive Ladungswechselschleife deutlich reduziert wird und zu
Wirkungsgradnachteilen führt. Im Bereich sehr niedriger Teillasten kann die Steu-
erzeit ES später als der wirkungsgradoptimale Zündwinkel liegen, sodass es auf-
grund der nötigen Spätzündung zu Verbrauchseinbußen kommt. Wie beim Last-
steuerverfahren FES ist auch beim Verfahren SES das effektive Verdichtungsver-
hältnis reduziert, da die eigentliche Kompression erst deutlich nach dem unteren
Totpunkt beginnt. Bei aufgeladenen Ottomotoren kann damit der Anfettungsbe-
darf im Nennleistungsbereich zum thermischen Bauteilschutz deutlich reduziert
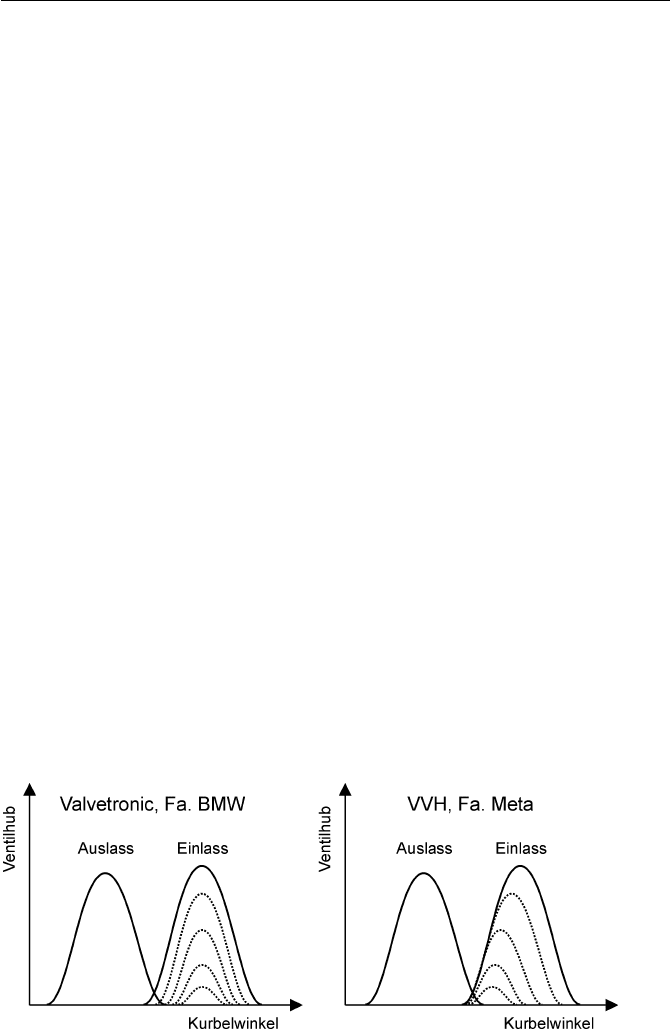
226 4 Relevante Subsysteme und Prozesse
werden. [FIO04] hat erfolgreich ein Verfahren an einem kleinen freisaugenden
Ottomotor umgesetzt, das durch unkonventionelle Ventilsteuerzeiten charakteri-
siert ist. Infolge des vollständigeren Ausnutzens der Expansionsarbeit durch SAÖ,
hohen AGR-Raten durch SAS sowie dem Reverse-Miller-Cycle (SES) sind deutli-
che Kraftstoffverbrauchssenkungen im unteren Teillastbereich in Höhe von etwa
8% möglich. Im Gegensatz zum Laststeuerverfahren FES wird beim Verfahren
SEÖ das Einlassventil erst während der Abwärtsbewegung des Kolbens geöffnet
und dann geschlossen, sobald sich die gewünschte Ladungsmenge im Zylinder
befindet. Die Steuerzeit ES kann damit deutlich vor oder deutlich nach dem unte-
ren Totpunkt liegen. Im ersten Fall sind sehr kurze Öffnungsdauern des Einlass-
ventils erforderlich. Zum Zeitpunkt EÖ herrscht eine große Druckdifferenz zwi-
schen Ansaugkanal und Brennraum, sodass die Frischladung mit hoher Geschwin-
digkeit in den Zylinder einströmt und ein turbulentes Strömungsfeld erzeugt wird,
welches zu einer schnellen Verbrennung führt. Nachteilig wirkt die durch den
späten Einlass-Schluss erhöhte Ladungswechselarbeit.
Bei der Laststeuerung durch Veränderung des maximalen Einlassventilhubs
findet die Drosselung im Bereich des Einlassventilsitzes statt und liegt auf einem
deutlich niedrigeren Niveau als bei der konventionellen Steuerung mittels Dros-
selklappe. Bei Teillast ist das Einlassventil nur wenig geöffnet. Da infolge des
geringen Ventilöffnungsquerschnittes hohe Strömungsgeschwindigkeiten und ein
turbulentes Strömungsfeld generiert werden, findet eine sehr gute Gemischaufbe-
reitung mit guten Hochdruckwirkungsgraden sowie stabiler und schneller
Verbrennung im gesamten Motorkennfeld statt. Im Vergleich zur Steuerung mit-
tels Drosselklappe treten geringere zyklische Schwankungen auf. Dieses System
eignet sich daher am besten zur drosselfreien Laststeuerung, zumal die geringen
Einlassventilhübe zu einer Senkung der Reibverluste des Ventiltriebs führen
[ACH03]. Bekannte Systeme sind die Valvetronic von BMW sowie das VVH-
System der Firma Meta [KRE03], siehe Abb. 4.58. Während die Valvetronic als
hubabsteuerndes System über nahezu konstante Lagen des Hubmaximums verfügt
und die Öffnungsdauer mit fallendem Ventilhub absinkt, verschieben sich das
Hubmaximum und die Steuerzeit ES beim VVH-System (hubaddierendes System)
mit sinkenden Ventilhüben nach früh.
Abb. 4.58. Variable Ventilsteuersysteme mit veränderlichen maximalen Einlassventilhüben
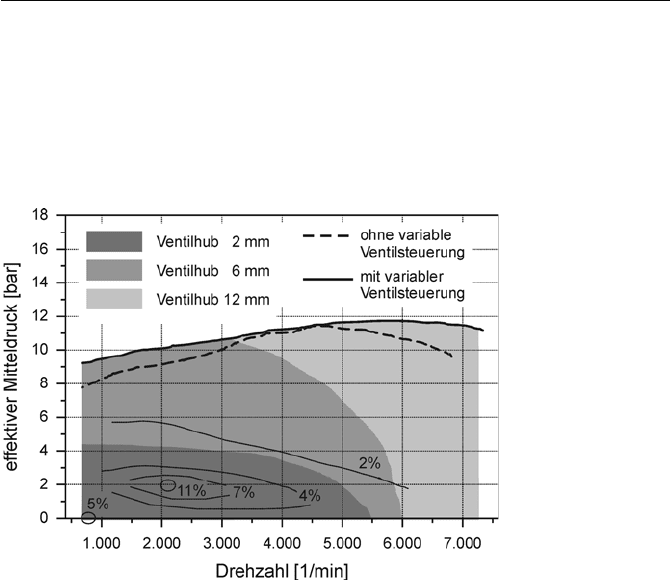
4.2 Variabilitäten und Prozesssteuerung 227
Einen Überblick über kontinuierlich derzeitige Systeme mit kontinuierlich vari-
ablem Ventilhub gibt [HAN04]. Schon einfachere Systeme mit einer dreistufigen
Ventilhubumschaltung und doppelten Phasenstellern ermöglichen sowohl eine
Kraftstoffverbrauchsreduzierung im unteren Teillastbereich als auch eine Steige-
rung der Leistungsdichte des Motors. In Abb. 4.59 sind die mit einem solchen
Stufensystem ermittelten Vorteile im Vergleich zum gleichen Motor ohne Ventil-
triebsvariabilitäten dargestellt.
Abb. 4.59. Kraftstoffreduktions-Potenziale einer dreistufigen Ventilhubumschaltung mit
Phasenstellern auf der Einlass- und Auslassseite [KRE03b]
Basis der Untersuchungen bildet ein freisaugender 4-Zylinder Ottomotor
(
V
H
= 1,8 dm
3
). Im Vergleich zum Basismotor kann der Kraftstoffverbrauch in
weiten Teillast-Kennfeldbereichen deutlich reduziert werden. Die bedarfsgerechte
Luftversorgung des Motors führt zu einer Steigerung des Low-End-Torque sowie
zu einer Erhöhung der maximalen Leistung. Mittels vollvariabel arbeitenden Sys-
temen sind noch umfangreichere Verbesserungen hinsichtlich Drehmoment, Leis-
tung und Kraftstoffverbrauch realisierbar, vergleiche [KRE03].
Restgassteuerung (innere Abgasrückführung)
Das Rückströmen von Abgas aus dem Auslasskanal in den Brennraum oder den
Ansaugkanal wird als innere Abgasrückführung bezeichnet und bestimmt im We-
sentlichen den Restgasgehalt im Brennraum. Die innere Abgasrückführung ist nur
bei einem negativen Druckgefälle zwischen Einlass- und Auslasskanal möglich.
Bei aufgeladenen Motoren, die in der Regel über ein positives Spülgefälle verfü-
gen, muss die Ansaugluft zur Darstellung einer inneren AGR daher angedrosselt
werden. Drosselgesteuerte Ottomotoren können in der Teillast mit innerer AGR
betrieben werden. Bei aufgeladenen Dieselmotoren ist hier eine zusätzliche An-
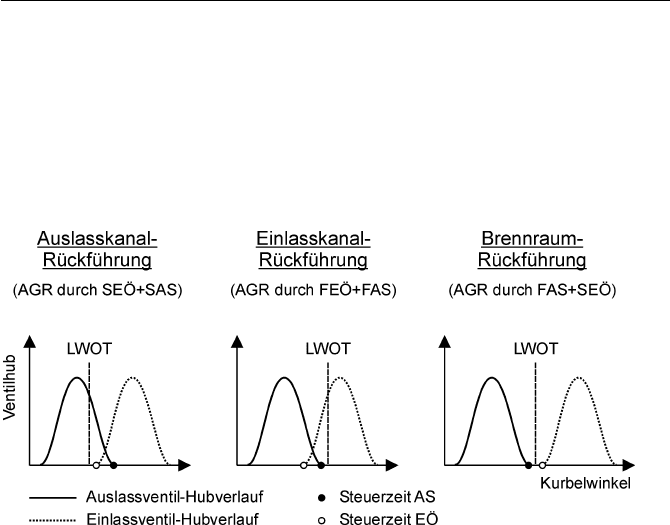
228 4 Relevante Subsysteme und Prozesse
drosselung erforderlich, um intern Abgas rückführen zu können. Der Restgasanteil
beeinflusst zahlreiche motorische Kenngrößen sowie die Betriebscharakteristik
und die Abgasemissionen, siehe Abschn. 4.2.1.
Mit Hilfe variabler Ventilsteuerungen kann die Ventilüberschneidung gezielt
gesteuert und damit der Restgasgehalt über eine innere Abgasrückführung in wei-
ten Bereichen dosiert werden. Maßgeblich hierfür sind die Steuerzeiten AS und
EÖ. Je nach Lage dieser Steuerzeiten erfolgt die innere Abgasrückführung auf
unterschiedlichen Weise [PIS99], siehe Abb. 4.60.
Abb. 4.60. Möglichkeiten der Restgassteuerung durch innere Abgasrückführung mit Hilfe
variabler Ventilsteuerung
Bei der Auslasskanalrückführung liegen die Steuerzeiten EÖ und AS nach den
oberen Totpunkt des Ladungswechsels (LWOT). Dabei saugt der Kolben Abgas
aus dem Abgaskanal zurück in den Brennraum. Im weiteren Verlauf der Kolben-
bewegung vermischt sich das bis AS einströmende Abgas mit dem Frischgemisch.
Im Falle der Einlasskanalrückführung liegen die relevanten Steuerzeiten vor
dem LWOT, sodass der sich aufwärts bewegende Kolben das Abgas auch in den
schon geöffneten Ansaugkanal schiebt. Diese Abgasteilmenge strömt dann im
darauf folgenden Zyklus in den Brennraum ein. Für sehr kleine Einlassventilhübe
ist die Restgassteuerung über die Einlasskanalrückführung nicht zielführend, da
die Ladungswechselverluste infolge des begrenzten Einlassventilquerschnittes
deutlich ansteigen [HAG02].
Bei der Brennraumrückführung liegt keine Ventilüberschneidung vor. Das Aus-
lassventil schließt bereits vor dem LWOT, und das Einlassventil öffnet um den
LWOT. Damit wird ein Teil des Restgases – je nach Lage der Steuerzeit EÖ –
entweder bis zum OT oder bis EÖ komprimiert. Durch Expansion des verdichteten
Restgases in den Ansaugkanal entstehen bei zu früher Lage von EÖ nennenswerte
Ladungswechselverluste. Allerdings ist hiermit eine gute Durchmischung mit dem
Frischgemisch gegeben.
Generell wird die Restgassteuerung durch innere Abgasrückführung vorwie-
gend im Teillastbereich eingesetzt. Hier sind in erster Linie eine zuverlässige und
schadstoffarme Verbrennung die wesentlichen Zielgrößen. Durch Reduzierung der

4.2 Variabilitäten und Prozesssteuerung 229
Ventilüberschneidung und damit der Restgasgehalte können beim Ottomotor deut-
liche Vorteile im Leerlaufverhalten ermöglicht werden. Im volllast- und Nennleis-
tungsbereich sind ebenfalls geringe Restgasgehalte im Sinne hoher Zylinderfül-
lungen und die Nutzung gasdynamischer Effekte erwünscht. Auf der anderen Seite
bieten variable Ventilsteuerungen im mittleren Kennfeldbereich günstige Voraus-
setzungen für eine schadstoffarme Verbrennung, ohne dass eine äußere Abgas-
rückführung zwingend nötig ist.
Ventilabschaltung
Bei Mehrventilmotoren können durch Abschaltung bzw. Stilllegung einzelner
Ventile bei Teillast gezielte Ladungsbewegungen generiert werden. Die Erzeu-
gung einer Drallströmung durch Deaktivierung eines Einlassventils ist wirkungs-
voller als bei einer Kanalabschaltung oder einem Drallkanal und eignet sich glei-
chermaßen für Otto- und Dieselmotoren [BAS04]. Damit können bei Ottomotoren
die Verbrennung stabilisiert und die Restgasverträglichkeit sowie der Magerlauf-
bereich ausgeweitet werden, sodass auch hinsichtlich der NO
x
-Emissionen Vortei-
le entstehen. Bei der dieselmotorischen Verbrennung unterstützt die Drallströ-
mung die Diffusionsverbrennung und führt zu intensiver Rußoxidation. Zur Dar-
stellung hoher Mitteldrücke müssen während des Ladungswechsels jedoch alle
Ventile aktiviert werden, um eine ausreichende Luftversorgung gewährleisten zu
können. Ventilabschaltung (VAS) kann daher nur im Teillastbetrieb eingesetzt
werden.
Ein weiterer Vorteil der Ventilabschaltung bei mechanischen Systemen ist die
damit verbundene Reduzierung der Ventiltriebsreibung, was mit einer weiteren
Kraftstoffverbrauchssenkung verbunden ist. Während eine Ventilabschaltung auf
der Auslassseite keinen grundlegenden Einfluss auf den Verbrennungsprozess
hervorruft, ist bei der einlassseitigen VAS sowohl die Einlasskanalgestaltung als
auch die Anordnung der Einspritzdüse von entscheidender Bedeutung.
Zylinderabschaltung
Die Zylinderabschaltung (ZAS) ist ein Verfahren zur Kraftstoffverbrauchssenkung
großvolumiger Motoren in der Teillast und kommt zweckmäßigerweise bei
Triebwerken mit acht oder zwölf Zylindern zum Einsatz. Die abzuschaltenden
Zylinder ergeben sich aus der Zündfolge des Motors, sodass auch im Falle der
Abschaltung einzelner Zylinder ein Motorbetrieb mit gleichmäßiger Zündfolge
erhalten bleibt. Damit sind die möglichen Triebwerkskonzepte, die für eine ZAS
geeignet sind, weitgehend festgelegt.
Bei der ZAS werden die Auslass- und Einlassventile sowie die Kraftstoffein-
spritzung einzelner Zylinder im Teillastbereich vollständig deaktiviert. Die
verbleibenden, aktiven Zylinder arbeiten zur Generierung des gewünschten Dreh-
momentes auf einem höheren Lastniveau mit entsprechend höheren Wirkungsgra-
den bzw. geringerem Kraftstoffverbrauch. Eine vollständige Deaktivierung der
Ventile ist deshalb einer reinen Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr vorzuziehen,
da hiermit keinerlei Drossel- oder Strömungsverluste entstehen, die deaktivierten

230 4 Relevante Subsysteme und Prozesse
Zylinder nicht auskühlen und die Lambda-Regelung für die aktiven Zylinder nicht
beeinträchtigt wird. Mit Blick auf einen hohen Schwingungs- und Geräuschkom-
fort ist ein gleichmäßiger Zündabstand sowie eine symmetrische Aufteilung der
aktiven und deaktivierten Zylinder erforderlich.
Die Zylinderabschaltung wird aufgrund der Variation des „aktiven“ Hubvolu-
mens auch als dynamisches Downsizing oder als Displacement-On-Demand
(DOD) bezeichnet. Details zu den Betriebspunktverlagerungen und damit verbun-
dene Kraftstoffeinsparmöglichkeiten werden in Abschn. 3.2.3 beschrieben.
Eine interessante Variante der Zylinderabschaltung stellt das 12-Taktverfahren
dar, bei dem nach Ausschieben des Abgases zunächst drei sogenannte Leertakte
gefahren werden, bevor der Kolben wieder Frischladung ansaugt. Im Gegensatz
zum 4-Taktverfahren (
i = 1/2) findet nicht alle zwei Kurbelwellenumdrehungen
ein Arbeitsspiel statt, sondern nur alle sechs Umdrehungen (
i = 1/6). Diese Leer-
takte sind dadurch charakterisiert, dass alle Ventile geschlossen sind und somit
nahezu keine Ladungswechselverluste auftreten. Zur Darstellung der gewünschten
Leistung müssen die Zylinder daher auf einem hohen Lastniveau betrieben wer-
den. Verglichen mit der klassischen Zylinderabschaltung, bei der einzelne Zylin-
der komplett deaktiviert werden, tragen beim 12-Taktverfahren alle Zylinder zur
Energieumsetzung bei, jedoch sinkt die jeweilige Anzahl der Arbeitspiele pro
Kurbelwellenumdrehung.
4.2.3 Variable Verdichtung
Die geometrische Verdichtung als Verhältnis von maximalem zu minimalem Zy-
lindervolumen ist ein wesentlicher Einflussparameter für zahlreiche motorische
Prozess- und Kenngrößen. Anhand der in Abschn. 2.2 beschriebenen, einfachen
Vergleichsprozesse lässt sich sehr anschaulich zeigen, dass der Wirkungsgrad
eines Verbrennungsmotors mit zunehmender Verdichtung degressiv ansteigt.
Dieser Wirkungsgradgewinn führt bei gleicher Energiezufuhr unmittelbar zu einer
höheren Leistung oder bei konstanter Leistung zu einer Absenkung des Kraftstoff-
verbrauchs. Die geometrische Verdichtung eines Motors sollte aus Verbrauchs-
und Leistungsgründen daher so hoch wie möglich gewählt werden.
Ein weiterer Vorteil ergibt sich aus der sinkenden Abgastemperatur, da hoch-
verdichtete Motoren durch die effektivere Verbrennung mehr Wärmeenergie in
mechanische Arbeit der Kurbelwelle umsetzen und damit weniger Energie über
das Abgas den Prozess verlässt [ROB03b].
Eine niedrige Verdichtung reduziert den aus Gründen des thermischen Bauteil-
schutzes notwendigen Anfettungsbedarf von aufgeladenen Ottomotoren im Be-
reich der Volllast bzw. der Nennleistung und führt zu einer Reduzierung des Kun-
denverbrauchs bei häufiger Ausnutzung des vollen Leistungspotenzials. Auch
wenn dieses nicht zyklusrelevant ist, können damit zusätzlich die in diesen Kenn-
feldbereichen emittierten Schadstoffe CO und HC deutlich abgesenkt werden.
Auf der anderen Seite führt eine Anhebung der Verdichtung unter der Voraus-
setzung gleichartiger Wärmezufuhr durch die Verbrennung (Brennstoffmenge,
Lage und Form des Brennverlaufs) grundsätzlich zu steigenden Zylinderspitzen-
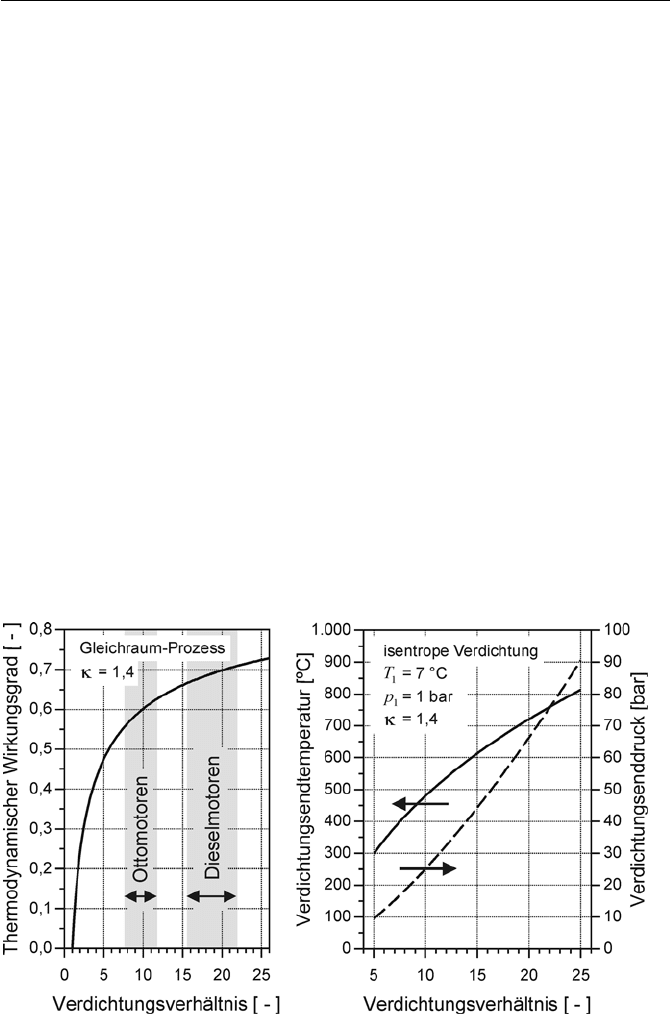
4.2 Variabilitäten und Prozesssteuerung 231
drücken und maximalen Gastemperaturen mit den Nachteilen einer hohen ther-
momechanischen Belastung der brennraumseitigen Bauteile und einer hohen NO
x
-
Emission. Allerdings kann die Restgasverträglichkeit bei Ottomotoren aufgrund
dieses höheren Temperatur- und Druckniveaus verbessert werden, sodass sich
insgesamt niedrigere Stickoxidemissionen und eine weitere Entdrosselung mit
positivem Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch ergeben. Die höhere Restgasver-
träglichkeit verbessert darüber hinaus die Laufruhe im Leerlauf durch Abnahme
der zyklischen Schwankungen, wobei die Drehzahlschwankungen aufgrund der
mit steigender Verdichtung zunehmenden Zylinderspitzendrücken zunehmen.
Dieser Sachverhalt kann insbesondere bei Dieselmotoren mit geringer Zylinder-
zahl zu Komfortbeeinträchtigungen führen.
Infolge prozentual steigender Volumenanteile der von der Flamme nicht erfass-
ten Brennraumbereiche nehmen die HC-Emissionen mit zunehmender Verdich-
tung zu. Diese lassen sich jedoch durch eine oxidierende Abgasnachbehandlung
relativ einfach verringern. Eine geringe Verdichtung der Zylinderladung verzögert
die Energieumsetzung in der Weise, dass sowohl der Zündverzug als auch die
Brenndauer ansteigen [KRA00]. Die Folge sind thermodynamische Verluste, die
auf einen schlechteren Gleichraumgrad zurückzuführen sind. Darüber hinaus stei-
gen die mechanischen Verluste durch eine Anhebung der Verdichtung (Zylinder-
druckniveau steigt) generell leicht an, doch kann dieser Nachteil durch die ther-
modynamischen Vorteile überkompensiert werden [CLE04].
Abbildung 4.61 zeigt den Einfluss des Verdichtungsverhältnisses auf den ther-
modynamischen bzw. thermischen Wirkungsgrad des Gleichraum-Prozesses und
die Verdichtungsendtemperatur sowie den Verdichtungsenddruck bei isentroper
Verdichtung unter Verwendung reiner Luft als Arbeitsgas.
Abb. 4.61. Einfluss der geometrischen Verdichtung auf motorische Prozessgrößen

232 4 Relevante Subsysteme und Prozesse
Hinsichtlich der Potenziale, die durch eine Steigerung der geometrischen Ver-
dichtung erschlossen werden können, bestehen zwischen dem Diesel- und dem
Ottomotor Unterschiede. Da der Dieselmotor aufgrund seines Arbeitsprinzips
ohnehin deutlich höher verdichtet ist als der Ottomotor, führt eine Anhebung der
geometrischen Verdichtung hier zu geringeren Wirkungsgradzuwächsen vergli-
chen mit dem Ottomotor. Ursache hierfür ist die mit steigender Verdichtung fal-
lende Tangentensteigung des Wirkungsgradverlaufs. Darüber hinaus ist der Die-
selmotor im Volllast-Bereich im Gegensatz zum Ottomotor nicht durch das Phä-
nomen des Klopfens begrenzt, sondern durch den maximalen Zylinderdruck. Die
Klopfproblematik beim Ottomotor, siehe Abschn. 3.4.2, tritt insbesondere bei
hohen Motorlasten auf und ist damit der begrenzende Faktor für die Festlegung
der geometrischen Verdichtung. Aufgrund des bei aufgeladenen Motoren im Ver-
gleich zu Saugmotoren höheren Zylinderdruck- und Gastemperaturniveaus erfor-
dert ein Betrieb diesseits der Klopfgrenze eine niedrigere Verdichtung, eine Spät-
verstellung des Zündwinkels sowie in bestimmten Bereichen eine Gemischanfet-
tung. Alle Maßnahmen führen generell zu einem höheren Kraftstoffverbrauch.
Im Teillastbereich ist die Gefahr des Auftretens klopfender Verbrennung weni-
ger gegeben, sodass hier durchaus höhere Verdichtungen mit dem Ziel einer Wir-
kungsgradsteigerung möglich sind. Es liegt daher nahe, das geometrische Verdich-
tungsverhältnis möglichst variabel an den Motorbetriebspunkt im Kennfeld anzu-
passen. Die Einsparungen im Kraftstoffverbrauch sind dabei umso größer, je häu-
figer der Motor im Teillastbereich betrieben wird und je höher der Aufladegrad
ist. Damit ist die variable Verdichtung (VCR – V
ariable Compression Ratio) spe-
ziell für hochaufgeladene Motoren interessant, die für einen klopffreien Betrieb
ansonsten sehr niedrige geometrische Verdichtungen und späte Zündzeitpunkte
benötigen. Bei großvolumigen Saugmotoren, die häufig im Teillastbereich betrie-
ben werden, ist ebenfalls ein Potenzial zur Kraftstoffverbrauchssenkung vorhan-
den. Allerdings ist dieses niedriger anzusetzen als bei aufgeladenen Motoren. Mit
Hilfe der variablen Verdichtung kann der Zündzeitpunkt über den gesamten Kenn-
feldbereich nahezu wirkungsgradoptimal eingestellt werden, ohne dass es zum
Klopfen kommt.
Neben den thermodynamischen Vorteilen einer variablen Verdichtung sind mit
diesem zusätzlichen Freiheitsgrad auch unterschiedliche Betriebsstrategien um-
setzbar. Beispielsweise kann die Verdichtung während des Warmlaufs reduziert
werden, um den Katalysator-Light-Off durch die höheren Abgastemperaturen zu
beschleunigen. Mit dieser Strategie lassen sich die zyklusrelevanten Emissionen
reduzieren, da speziell die Warmlaufphase hierbei einen beachtlichen Stellenwert
hat.
Abbildung 4.62 zeigt beispielhaft die möglichen geometrischen Verdichtungen
im Kennfeld eines turboaufgeladenen PFI-Ottomotors mit hoher spezifischer Leis-
tung. Hierbei sind sowohl der Lasteinfluss als auch der Drehzahleinfluss auf die
Klopfproblematik zu erkennen. Niedrigste Verdichtungen sind im Kennfeldbe-
reich mit geringer Drehzahl und hoher Last erforderlich. Mit zunehmender Dreh-
zahl nimmt die Klopfgefahr ab, sodass höhere geometrische Verdichtungen mög-
lich sind und damit ein hohes Potenzial zur Kraftstoffverbrauchsreduzierung nutz-
bar ist. Die Höhe der maximalen Verdichtung wird hierbei durch den notwendigen
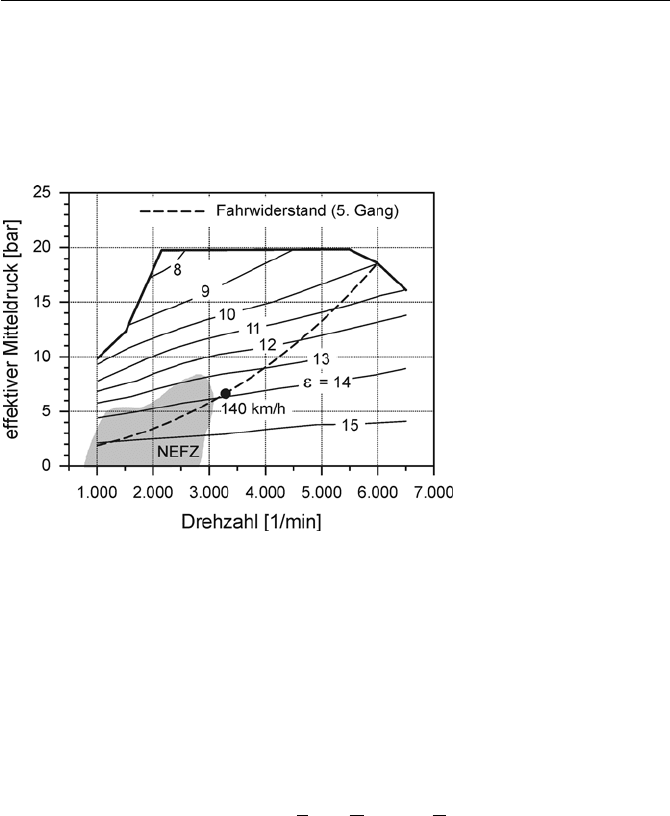
4.2 Variabilitäten und Prozesssteuerung 233
Ventilfreigang bei Einsatz einer Nockenwellenverstellung beschränkt. [PIS03b]
hat dieses Prinzip konstruktiv an einem serienmäßigen 4-Zylinder-PFI-
Turbomotor umgesetzt – der Verstellbereich liegt zwischen 8 und 16 – und keine
Einflüsse auf das Verbrennungsgeräusch sowie das NVH-Verhalten feststellen
können. Im Vergleich zum konventionellen Motor konnte der Kraftstoffverbrauch
im NEFZ durch die variable Verdichtung um 7,8% reduziert werden.
Abb. 4.62. Variation der geometrischen Verdichtung im Kennfeld eines PFI-Turbomotors
[PIS03b]
Im Laufe der Zeit sind zahlreiche konstruktive Ansätze zur Darstellung der va-
riablen Verdichtung bekannt geworden, die entweder die kinematischen Längen
des Kurbeltriebs variieren, eine Verschiebung der Lagerposition bewirken oder
das Kompressionsvolumen durch Schaltung von Nebenvolumina verändern, siehe
Abb. 4.63. Eine wesentliche Anforderung an VCR-Systeme sind geringe Rei-
bungsverluste, damit die thermodynamisch nutzbaren Potenziale nicht durch einen
niedrigeren mechanischen Wirkungsgrad aufgezehrt werden.
Saab hat einen mechanisch aufgeladenen Ottomotor mit variabler Verdichtung
– das sogenannte SVC-System (S
aab Variable Compression) – vorgestellt
[DRA02], bei dem das Verdichtungsverhältnis durch Kippen des gesamten Zylin-
derkopfes vorgenommen wird. [SCH02] hat unterschiedliche Konzepte hinsicht-
lich der Realisierbarkeit bewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass eine
Verschiebung der Kurbelwelle bzw. des gesamten Kurbeltriebs in Richtung Zylin-
derkopf hinsichtlich der wesentlichen Kriterien Energieaufwand für die Verstel-
lung, konstruktiver Aufwand, zusätzliche Massenkräfte, Stabilität/Selbsthemmung
sowie Steuerbarkeit die Ziel führendste Möglichkeit darstellt.
Aufgrund des durch die gesteigerte Verdichtung möglichen höheren Wirkungs-
grades im Teillastbereich wird das verfügbare Drehmoment angehoben. Die vari-
able Verdichtung ist somit auch eine geeignete Maßnahme, um das transiente
Betriebsverhalten zu verbessern. Dieser Vorteil wirkt sich insbesondere bei turbo-
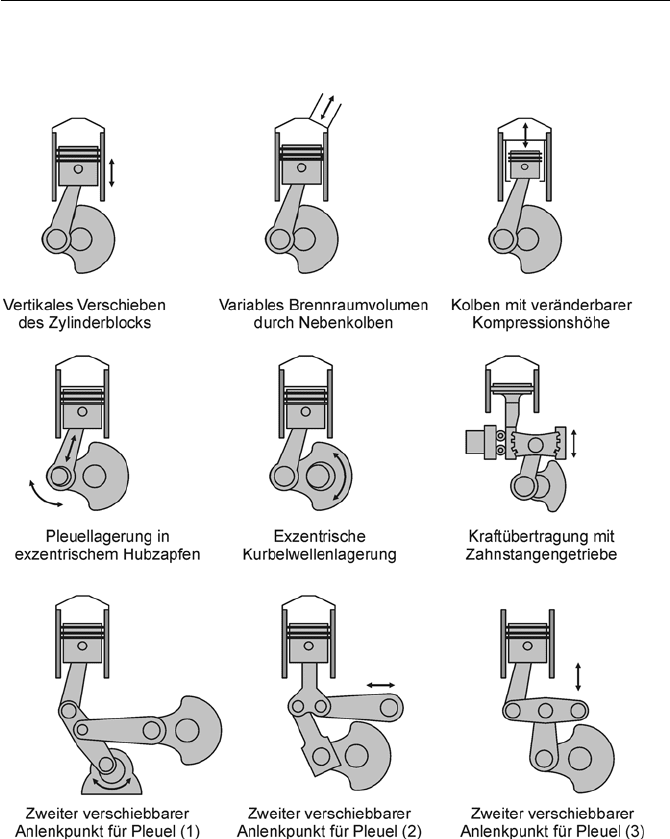
234 4 Relevante Subsysteme und Prozesse
aufgeladenen Motoren aus, die bei niedrigen Drehzahlen infolge des unzureichen-
den Abgasenergieangebotes für die Turbine nur verzögert Ladedruck aufbauen.
Abb. 4.63. Konstruktive Prinzipien zur Realisierung variabler Verdichtung
Bei den direkteinspritzenden Dieselmotoren ist in den letzen Jahren in Verbin-
dung mit einer gesteigerten Leistungsdichte ein stetiger Trend zu niedrigeren
Verdichtungsverhältnissen zu beobachten. Ursache hierfür ist in erster Linie die
Einhaltung der strengen Abgasgesetzgebung, insbesondere der NO
x
- und Ruß-
emissions-Grenzwerte, wodurch hinsichtlich des Kraftstoffverbrauchs Nachteile
entstehen. Zudem können die Zylinderspitzendrücke mit niedriger Verdichtung
auf einem erträglichen Niveau gehalten werden, sodass die mechanische Trieb-
werks- bzw. Motorbelastung trotz hoher Leistungsdichte beherrschbar bleibt
