Golloch R. Downsizing bei Verbrennungsmotoren: Ein wirkungsvolles Konzept zur Kraftstoffverbrauchssenkung
Подождите немного. Документ загружается.


4.3 Gemischaufbereitung und Verbrennung 235
[COO03]. Allerdings muss stets gewährleistet sein, dass der Motor auch bei sehr
niedrigen Außentemperaturen zuverlässig startet (Kaltstartfähigkeit). Aufgrund
der Notwendigkeit, die Selbstzündtemperatur des Kraftstoffes zu erreichen, kann
die geometrische Verdichtung beim Dieselmotor nicht zu weit abgesenkt werden.
Die bei niedriger Verdichtung geringeren maximalen Gastemperaturen führen
einerseits zu einer geringeren NO
x
-Bildungsrate, andererseits wird die Rußoxida-
tion durch die höhere Abgastemperatur und den durch längeren Zündverzug er-
höhten vorgemischten Verbrennungsanteil intensiviert, sodass die Partikel- und
Stickoxidemissionen in der Summe sinken. Beim dieselmotorischen Brennverfah-
ren bietet die variable Verdichtung somit ein nutzbares Potenzial zur Senkung der
Schadstoffemissionen, ohne auf eine hohe Leistungsausbeute im Bereich der Voll-
last verzichten zu müssen.
4.3 Gemischaufbereitung und Verbrennung
Die chemische Umsetzung des Kraftstoffes im Brennraum muss unter allen Be-
dingungen und innerhalb des gesamten Motorkennfeldes gesteuert erfolgen. Ziel-
größen sind die Einhaltung der Schadstoffgrenzwerte, ein geringer Kraftstoff-
verbrauch sowie ein gutes Laufverhalten des Motors bei geringer Geräuschemissi-
on. Durch Variation der zur Steuerung der Verbrennung geeigneten Betriebspara-
meter sind in der Regel nicht alle Ziele gleichzeitig zu erreichen, sodass Prioritä-
ten gesetzt und Kompromisse gefunden werden müssen. So haben insbesondere
die gesetzlichen Vorgaben zur Schadstoffreglementierung in den letzten Jahren
dazu beigetragen, dass die Potenziale zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs nicht
voll ausgeschöpft werden konnten.
Der Begriff Brennverfahren beschreibt die zur Steuerung der Gemischbildung
und Verbrennung ergriffenen Maßnahmen, die ihrerseits durch Prozessparameter
und konstruktive Randbedingungen beeinflusst werden. Ein bestimmtes Brennver-
fahren lässt sich zunächst über die einzelnen Prozessschritte Kraftstoffeinbrin-
gung, Gemischbildung, Zündung und Verbrennung charakterisieren. Jeder dieser
Einzelprozesse wird in seinem Ablauf durch zahlreiche Parameter beeinflusst.
Bestimmend für die Güte des Brennverfahrens ist jedoch das Zusammenspiel der
einzelnen Maßnahmen. Aufgrund der Vielfalt der Einflussparameter kommt dieser
Feinabstimmung eine besondere Bedeutung zu. Beispiele für Parameter und Maß-
nahmen zur Prozessoptimierung sind die Kolbenmuldengeometrie, die Anzahl und
Anordnung der Einspritzdüsenlöcher oder die Ladungsbewegung während der
Gemischbildung – um nur einige wenige zu nennen.
Durchgesetzt haben sich das ottomotorische und das dieselmotorische Brenn-
verfahren. Um den zukünftigen Anforderungen insbesondere hinsichtlich der
Schadstoffemissionen gerecht werden zu können, sind diese beiden klassischen
Brennverfahren zu modifizieren bzw. gänzlich neuartige Brennverfahren zu ent-
wickeln. Dabei ist zu beachten, dass der Kraftstoff selbst auch einen bedeutsamen
Einfluss auf die Wahl des Brennverfahrens ausübt. Der Einsatz synthetisch herge-
stellter Kraftstoffe mit in bestimmten Bereichen gezielt steuerbaren physikalisch-

236 4 Relevante Subsysteme und Prozesse
chemischen Eigenschaften bietet daher noch ein beachtliches Potenzial, dessen
Nutzung die Motorenentwicklung noch viele Jahre beschäftigen wird. Mit Blick
auf die Realisierung von Downsizing-Konzepten sind jedoch nicht alle Brennver-
fahren gleichermaßen geeignet. So ist es beispielsweise mit dem heutigen Stand
der Technik für Großserienanwendungen noch nicht möglich, homogene diesel-
motorische Brennverfahren mit hohem Luftüberschuss bei sehr hohen Mitteldrü-
cken zu realisieren.
Grundsätzlich wird zwischen Luftansaugung und Gemischansaugung unter-
schieden. Bei luftansaugenden Motoren erfolgen der Kraftstoffeintrag und die
Gemischbildung innerhalb des Brennraumes. Im Gegensatz dazu erfolgt die Ge-
mischbildung bei gemischansaugenden Motoren außerhalb des Brennraumes.
Während heutige Dieselmotoren ausschließlich luftansaugend arbeiten, sind bei
Ottomotoren beide Varianten zu finden. Die folgenden Abschnitte sollen einen
Überblick über die grundsätzlichen Eigenschaften und Charakteristiken der ein-
zelnen Gemischbildungs- und Brennverfahren verschaffen.
4.3.1 Grundlagen
Die Prozesse der Verbrennung und Schadstoffbildung im Motor und damit die
wesentlichen Motorcharakteristiken wie Kraftstoffverbrauch, Drehmoment, Leis-
tung, Verbrennungsgeräusch und Schadstoffausstoß hängen in entscheidendem
Ausmaß von der Zuführung und Aufbereitung des Kraftstoffes ab. Mit Blick auf
die Forderung nach hohen spezifischen Leistungen und Drehmomenten sind bei
Downsizing-Konzepten relativ große Kraftstoffmengen innerhalb kurzer Zeit in
den Brennraum einzubringen und mit der Luft zu vermischen. Die thermodynami-
schen Vorteile, die direkteinspritzende bzw. luftansaugende Motoren im Vergleich
zu gemischansaugenden Motoren bieten, führen jedoch zu gesteigerten Anforde-
rungen an die Gemischbildungssysteme, da für die relevanten Prozesse im Ver-
gleich zur Gemischansaugung deutlich weniger Zeit zur Verfügung steht. Dem
Kraftstoffeinspritzsystem kommt daher eine Schlüsselrolle zu.
Um die strengen Emissionsstandards sowie die kundenseitigen Wünsche erfül-
len zu können, benötigen moderne Einspritzsysteme eine Vielzahl von Freiheits-
graden. Neben einer gezielten Steuerung von Einspritzbeginn und –dauer zeigen
Maßnahmen zur kurbelwinkeldiskreten Variation von Einspritzdruck und Kraft-
stoffzuführung (Einspritzverlauf) nutzbare Potenziale auf.
Im Gegensatz zum Ottomotor, der zum einen als konventioneller und sehr zu-
verlässiger Motor mit Gemischansaugung durch Saugrohreinspritzung, aber zu-
nehmend auch als Direkteinspritzer betrieben werden kann, hat sich beim Diesel-
motor die direkte Kraftstoffeinspritzung in den Brennraum durchgesetzt. Langfris-
tig wird auch beim Ottomotor ein eindeutiger Trend zur Direkteinspritzung zu
beobachten sein, da sie neben der Nutzung thermodynamischer Vorteile sehr gut
mit der Abgasturboaufladung kombiniert werden kann. Dennoch hat sich die Ein-
führung der Direkteinspritzung beim Ottomotor als ungleich schwieriger als beim
Dieselmotor herausgestellt, da nach wie vor zum Zeitpunkt der Entflammung, die
durch Fremdzündung eingeleitet wird, im Bereich der Zündkerze ein zündfähiges
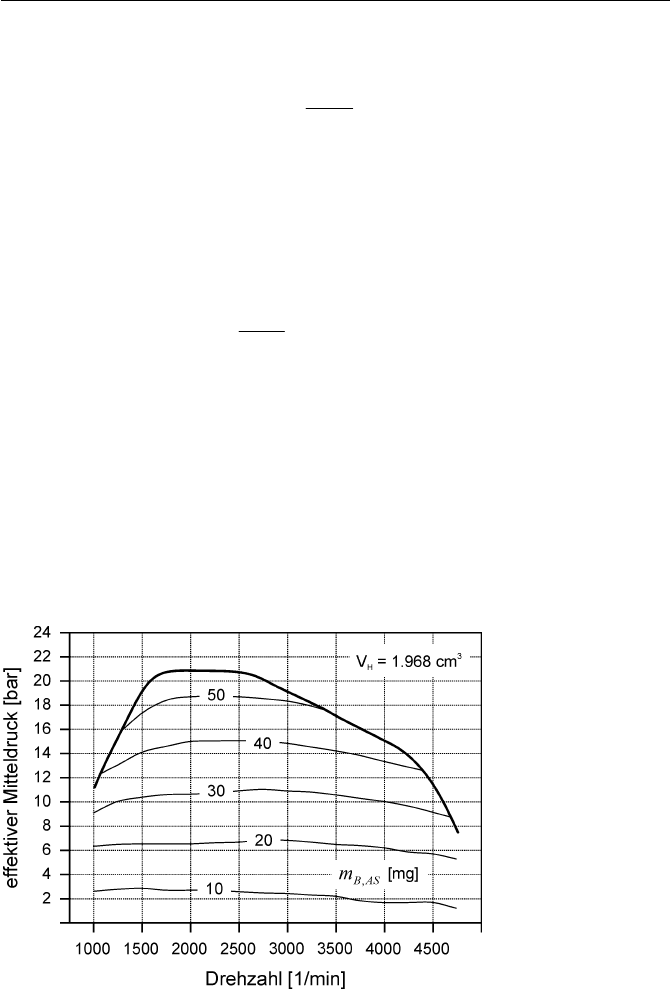
4.3 Gemischaufbereitung und Verbrennung 237
Gemisch mit engen Ȝ-Grenzen vorliegen muss. Unabhängig vom Brennverfahren
gilt für die Menge des pro Arbeitsspiel und Zylinder eingespritzten Kraftstoffes
z
ni
m
m
B
ASB
,
.
(4.63)
Der dem Motor zugeführte Brennstoffmassenstrom entspricht dabei dem Pro-
dukt aus spezifischem Brennstoffverbrauch und effektiver Motorleistung
meheeeB
pVznibPbm
,
(4.64)
sodass sich für die auf das Zylinderhubvolumen bezogene und pro Zylinder und
Arbeitsspiel eingespritzte Kraftstoffmasse die folgende Beziehung ergibt:
mee
h
ASB
pb
V
m
,
.
(4.65)
Unter der Annahme eines konstanten spezifischen Kraftstoffverbrauchs ist die
eingespritzte Kraftstoffmasse direkt proportional zum effektiven Mitteldruck des
Motors. Downsizing-Konzepte, die durch sehr hohe Mitteldrücke charakterisiert
sind, stellen aufgrund der großen Lastspreizung und der Notwendigkeit exakter
Kraftstoffzumessung besondere Anforderungen an das Einspritzsystem.
Abbildung 4.64 zeigt beispielhaft für einen modernen Pkw-Dieselmotor die ü-
ber Last und Drehzahl eingespritzten Kraftstoffmengen. Da der Kraftstoff-
verbrauch an der Volllast im Bereich des maximalen Mitteldruckes von 20,9 bar
etwa 200 g/kWh beträgt, werden etwa 59 mg Kraftstoff pro Zylinder und Arbeits-
spiel eingespritzt.
Abb. 4.64. Eingespritzte Kraftstoffmasse pro Zylinder und Arbeitsspiel für einen modernen
4-Zylinder-Pkw-DI-Dieselmotor mit Abgasturboaufladung
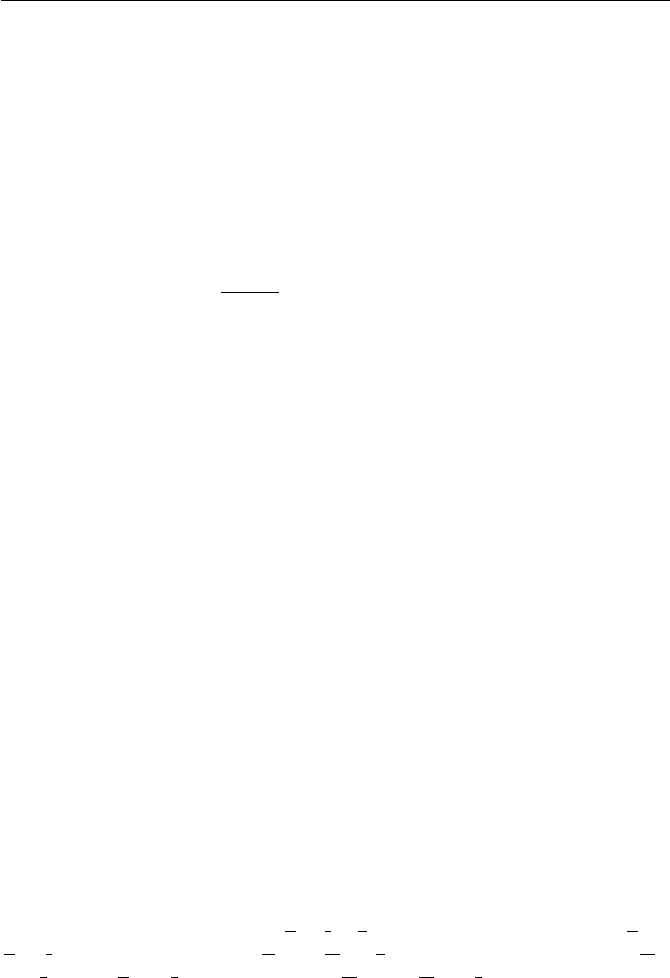
238 4 Relevante Subsysteme und Prozesse
Das entspricht einer bezogenen Kraftstoffmasse von 116 mg/dm
3
. Deutlich hö-
here effektive Mitteldrücke bis über 30 bar führen zwar zu einer Senkung des
spezifischen Kraftstoffverbrauches, erhöhen jedoch die dafür erforderlichen Kraft-
stoffmassen signifikant. Bei Annahme eines Kraftstoffverbrauchs von 200 g/kWh
werden für 30 bar Mitteldruck etwa 167 mg/dm
3
in die Brennräume eingespritzt.
Ottomotoren erfordern aufgrund des geringeren Wirkungsgrades im Volllastbe-
reich deutlich höhere Einspritzmengen, die deutlich über 200 mg/dm
3
betragen
können.
Der gesamte Brennstoffmassenstrom, der dem Motor zugeführt werden muss,
berechnet sich zu
Hmee
L
B
Vnipb
L
m
m
min
O
.
(4.66)
Für das obige Beispiel (
b
e
= 200 g/kWh, p
me
= 30 bar) eines Viertakt-Motors
mit einem Motorhubvolumen von 2.000 cm
3
und einer Drehzahl von 3.000 1/min
bedeutet das einen Kraftstoffmassenstrom in Höhe von 30 kg/h.
Während bei der ottomotorischen Saugrohreinspritzung durch Vorlagerung des
Kraftstoffes vor dem Einlassventil trotz der großen Kraftstoffmengen die Ge-
mischbildung in weiten Bereichen sehr zuverlässig abläuft, ist bei direkteinsprit-
zenden Systemen die für die Gemischbildung zur Verfügung stehende Zeit ver-
gleichsweise kurz, sodass bereits seitens des Einspritzsystems günstige Vorausset-
zungen für die Gemischbildung geschaffen werden müssen. Daher werden ein
schneller Strahlaufbruch, kleine Tropfendurchmesser und eine intensive und
schnelle Vermischung mit der Luft gefordert. Bei Dieselmotoren, deren Kraftstoff
im Vergleich zum Ottokraftstoff eine höhere Viskosität aufweist und über schwe-
rer verdampfende Komponenten verfügt, sind die Einspritzdrücke daher bis heute
auf über 2.000 bar angestiegen, wobei die Durchmesser der Einspritzdüsenspritz-
löcher im Pkw-Sektor auf etwa 120 µm gesunken sind. Zur weiteren Mitteldruck-
und Leistungssteigerung wird die Gemischbildung bei direkteinspritzenden Moto-
ren zukünftig weiter in Richtung Einspritzsystem verschoben.
Um die einzelnen Prozesse während der Einspritzung und Gemischbildung be-
schreiben zu können, ist eine Unterscheidung zwischen Otto- und Dieselmotoren
nötig, da sie sich sowohl kraftstoff- als auch brennverfahrensseitig stark vonein-
ander unterscheiden.
Otto-Verfahren
Charakteristisch für das Otto-Verfahren ist die Fremdzündung mittels Zündkerze.
Man unterscheidet zwischen der S
augrohreinspritzung (SRE) – englisch: Port-
F
uel-Injection (PFI) – und der Benzin-Direkteinspritzung (BDE) – englisch: Di-
rect-I
njection-Spark-Ignition (DISI) bzw. Gasoline Direct Injection (GDI). Verga-
sersysteme kommen nur noch bei Kleinstmotoren zum Einsatz und sollen hier
nicht betrachtet werden. Demnach kommt sowohl ein gemischansaugendes
Brennverfahren als auch ein luftansaugendes Brennverfahren zum Einsatz. Die
Lastregelung erfolgt überwiegend durch Regelung der Gemischmenge (Quanti-
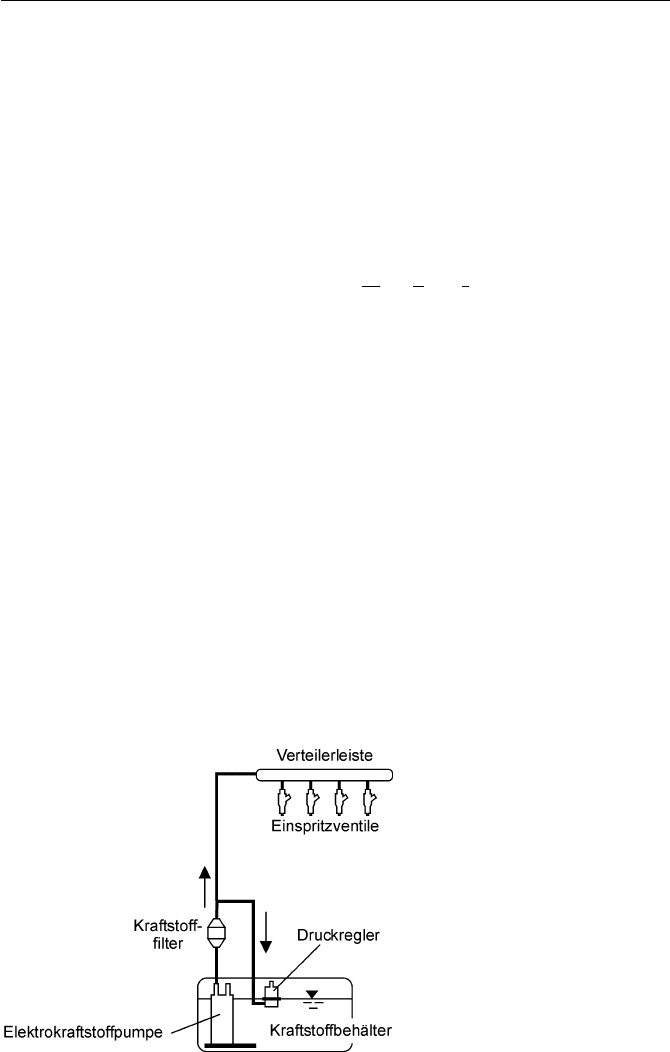
4.3 Gemischaufbereitung und Verbrennung 239
tätsregelung), bei direkteinspritzenden Motoren mit Schichtladung auch durch
Qualitätsregelung. Aufgrund der Klopfproblematik werden Ottomotoren – je nach
Brennverfahren – mit geometrischen Verdichtungen von 7-13 gefahren. Dadurch
werden Selbstzündprozesse bzw. Klopfen ausgeschlossen, und es liegt ein klar
definierbarer Verbrennungsbeginn durch Festlegung des Zündzeitpunktes vor.
Saugrohreinspritzung (SRE, PFI)
Die Einspritzung des Kraftstoffes ins Saugrohr bewirkt beim klassischen SRE-
Ottomotor eine außerhalb des Brennraumes beginnende Gemischbildung im Saug-
rohr, die erst zum Ende der nachfolgenden Kompressionsphase abgeschlossen ist
und zu einem weitgehend homogenen Gemisch führt. Heute sind nur noch elekt-
ronisch gesteuerte Einzeleinspritzsysteme (M
ulti-Point-Injection, MPI) von Be-
deutung, die den Kraftstoff mit einem Druck von 3-5 bar über je ein Einspritzven-
til in die Saugrohre der einzelnen Zylinder zuführen und dort vorlagern. Hierbei
kommen unterschiedliche Einspritzarten – simultane Einspritzung, Gruppenein-
spritzung, sequenzielle Einspritzung oder zylinderindividuelle Einspritzung - zum
Einsatz. Das Einspritzsystem hat nun die Aufgabe, den Kraftstoff in Abhängigkeit
des Brennverfahrens, des Motorbetriebspunktes und der Umgebungsbedingungen
unter hohem Druck, in der richtigen Menge nach dem gewählten Einspritzverlauf
und zum richtigen Zeitpunkt zuzuführen.
Abbildung 4.65 zeigt die Einspritzsystemkomponenten für gemischansaugende
Ottomotoren. Eine Elektrokraftstoffpumpe erzeugt den Einspritzdruck und fördert
den Kraftstoff über einen Kraftstofffilter und den Kraftstoffverteiler zu den Ein-
spritzventilen. Der Systemdruck beträgt 3,0-4,5 bar. Im dargestellten rücklauffrei-
en System befindet sich der Druckregler in unmittelbarer Nähe des Kraftstoffbe-
hälters, sodass die von der Pumpe geförderte Mehrmenge sofort in den Tank ge-
fördert wird und nicht den Umweg über den Motorraum mit der damit verbunde-
nen Kraftstofferwärmung nehmen muss. Beim bedarfsgeregelten System wird nur
gerade soviel Kraftstoff gefördert, wie der Motor verbraucht. Dabei erfolgt die
Druckregelung über einen geschlossenen Regelkreis im Motorsteuergerät mit
Druckerfassung über einen Drucksensor.
Abb. 4.65. Systemkomponenten für die ottomotorische Saugrohreinspritzung

240 4 Relevante Subsysteme und Prozesse
Vorteile dieser Variante sind eine Kraftstoffverbrauchssenkung in Höhe von
etwa 0,1 l/100 km [ROB03a] infolge geringerer Antriebsleistung für die Kraft-
stoffpumpe sowie eine Systemdruckvariation, die zur Anpassung an unterschiedli-
che Betriebsbedingungen wie z.B. Heißstart genutzt werden kann.
Beim Öffnen des Einlassventils reißt die angesaugte Luftmenge die Kraftstoff-
wolke in den Zylinder und bewirkt durch Verwirbelung die Bildung eines zündfä-
higen Gemisches. Die elektronische Saugrohreinspritzung ermöglicht heute unter
allen Betriebsbedingungen eine zuverlässige Aufbereitung des Kraftstoffes und
die Generierung sicherer Zündbedingungen. Damit das homogene Gemisch über-
haupt entflammt werden kann, ist ein Luftverhältnis von 0,8-1,2 notwendig. Die
von der Zündkerze ausgehende Flammenfront breitet sich mit einer Geschwindig-
keit von etwa 20-25 m/s aus. Damit werden Brenndauern von ca. 30-50 °KW
erreicht. Mit Blick auf hohe Wirkungsgrade sind – entsprechend den Verhältnis-
sen beim Gleichraumprozess – kürzere Brenndauern wünschenswert. Positiven
Einfluss hierauf haben kompakte Brennräume mit kurzen Flammenwegen, höhere
Ladungsdichte durch hohes Verdichtungsverhältnis und hohe Mitteldrücke sowie
eine intensive Ladungsbewegung durch Tumble- oder Drallströmungen. Eine
schnelle Energieumsetzung reduziert darüber hinaus die bei Ottomotoren charak-
teristischen zyklischen Schwankungen im Verbrennungsablauf. Ursache hierfür
sind Schwankungen des turbulenten Geschwindigkeitsfeldes und der örtlichen
Ladungszusammensetzung. Fette und magere Gemische verbrennen relativ lang-
sam, die Flammengeschwindigkeit nimmt deutlich ab, sodass der Zündwinkel
nach „früh“ verstellt werden muss. Hinsichtlich des Wirkungsgrades liegt ein
Optimum bei leicht mageren Luftverhältnissen von
Ȝ = 1,1-1,3 vor, da neben der
sinkenden Flammengeschwindigkeit auch der positive Einfluss durch Ladungs-
verdünnung berücksichtigt werden muss. Maximale Leistung wird bei leicht fetten
Gemischen mit
Ȝ = 0,8-0,9 erreicht, da hier hohe Flammengeschwindigkeiten
auftreten und nahezu der gesamte zur Verfügung stehende Luftsauerstoff umge-
setzt wird.
Die Lastregelung erfolgt bei SRE-Ottomotoren durch Quantitätsregelung, also
durch Regelung der Gemischmenge. Praktisch wird dies durch Drosselung der
Ansaugluft erreicht, indem entsprechend der einströmenden Luftmasse die Kraft-
stoffmasse zudosiert wird. Dieses Verfahren stellt einen bedeutenden Nachteil der
Saugrohreinspritzung gegenüber der Direkteinspritzung dar, da der effektive Wir-
kungsgrad im Teillastbetrieb durch hohe Ladungswechselverluste herab gesetzt
wird. Darüber hinaus kann ein Kontakt des Gemisches mit den Wänden entlang
der Strömungsrichtung sowohl im Ansaugtrakt als auch im Brennraum zu lokalen
Gemischanreicherungen und damit verbundenen unkontrollierbaren Kraftstoff-
konzentrationen führen. Aufgrund lokalen Luftmangels und geringer Temperatu-
ren an den Wänden läuft die Verbrennung in diesen Bereichen unvollständig ab.
Das Luftverhältnis liegt in weiten Kennfeldbereichen bei
Ȝ = 1, sodass eine sehr
effektive Abgasnachbehandlung mittels Drei-Wege-Katalysator möglich ist. Nur
in Hochlastbereichen und im Bereich des Nennleistungspunktes wird leicht fett
gefahren. Aufgeladene Motoren werden in den genannten Bereichen aufgrund der
Klopfproblematik und thermischer Überlastung noch fetter betrieben.
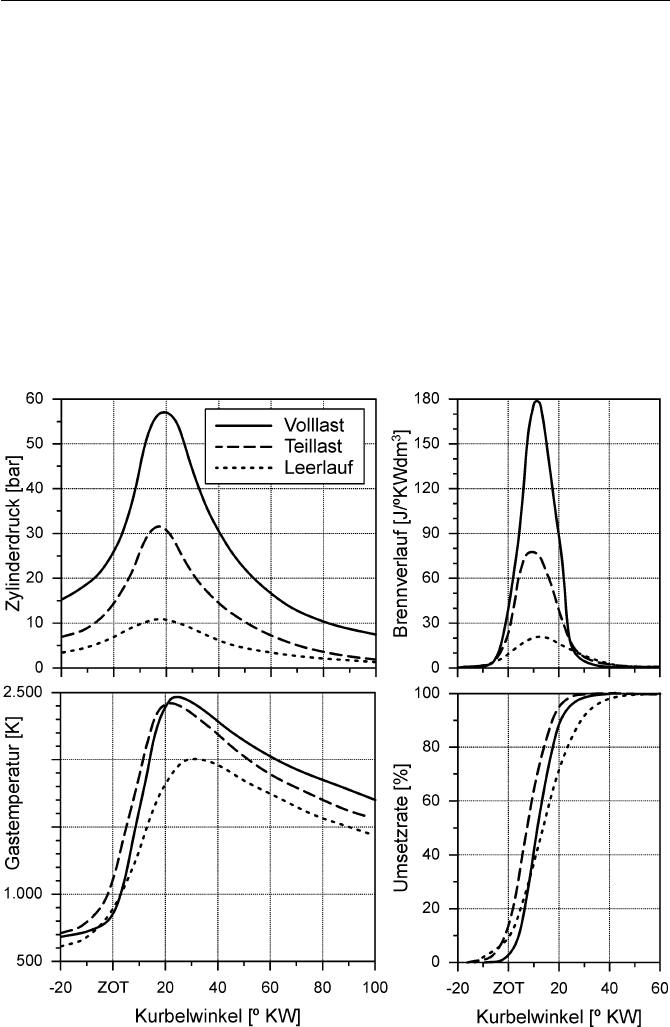
4.3 Gemischaufbereitung und Verbrennung 241
Ottomotoren reagieren auf Ladungsverdünnung durch zusätzliche Luft oder
Abgas hinsichtlich der Verbrennungsstabilität relativ empfindlich. Mit zunehmen-
der Verdünnung werden die Entflammungs- und Verbrennungsphase verlängert.
Im Falle von stöchiometrischer Verbrennung mit
Ȝ = 1 führt Abgasrückführung
infolge sinkender Drosselung bei Teillast zu einem Anstieg der Ladungsmasse und
zu höheren Wirkungsgraden. Eine wirkungsvolle Maßnahme zur Ausweitung der
Magerlauffähigkeit ist der Einsatz intensiver Ladungsbewegung. Diese kann durch
spezielle Formgebung der Einlasskanäle oder – bei Mehrventilmotoren – durch
Einlasskanalabschaltung erzeugt werden. Die dadurch aufgeprägten Drallströ-
mungen bleiben auch während der Kompression weitgehend erhalten und führen
zu einer intensiven Gemischbildung mit hohen Brenngeschwindigkeiten. Nachtei-
lig wirken sich die höheren Strömungsverluste infolge Ladungsbewegung aus.
[PIS02] hat eine Reihe von Motoren thermodynamisch untersucht. In Abb. 4.66
sind die Prozessgrößen Zylinderdruck, -temperatur sowie Brennverlauf und Um-
setzrate für einen konventionellen, freisaugenden SRE-Ottomotor dargestellt.
Abb. 4.66. Prozessgrößenverläufe beim 4-Takt-Ottomotor mit Saugrohreinspritzung
[PIS02]

242 4 Relevante Subsysteme und Prozesse
Dabei handelt es sich um einen Vierzylinder-Reihenmotor mit einem Verdich-
tungsverhältnis von 10, einer Nenneistung von 74 kW und einem maximalen Mit-
teldruck in Höhe von 10,6 bar. In den Diagrammen sind drei Lastpunkte mit effek-
tiven Mitteldrücken von 1 bar (Leerlauf), 5 bar (Teillast) und 10,6 bar (Volllast)
für eine Drehzahl von 3.000 1/min dargestellt.
Aufgrund der Drosselregelung sinkt die Ladungsmasse mit sinkender Last.
Zum Beginn der Verdichtung liegen damit unterschiedliche Drücke vor, sodass
die Druckverläufe lastabhängig unterschiedliche Amplituden aufweisen. Da stets
eine stöchiometrische Gemischzusammensetzung vorliegt und die maximalen
Gastemperaturen in erster Linie vom Luftverhältnis beeinflusst werden, sind die
Temperaturverläufe sehr ähnlich. Die Verbrennungsgeschwindigkeit wird durch
die Turbulenz und den Restgasgehalt beeinflusst und steigt mit zunehmender Last,
was anhand der Umsetzrate und des Brennverlaufes deutlich wird. Eine Steige-
rung der Ladelufttemperatur erhöht das gesamte Temperaturniveau während der
Verdichtung. Damit nehmen Vorreaktionen und Radikalenbildung zu, aus der eine
erhöhte Klopfneigung resultiert.
Direkteinspritzung (BDE, DISI)
Die ottomotorische Benzin-Direkteinspritzung bietet gegenüber der Saugrohrein-
spritzung thermodynamische Vorteile in den Teilprozessen Gemischbildung, La-
dungswechsel und ggf. Verbrennung. Es wird daher seit langem an einer prakti-
schen Umsetzung dieses Brennverfahrens gearbeitet. Bereits 1937 wurde die BDE
bei einem Flugzeugmotor eingesetzt. 1951 hat die Firma Gutbrod mit dem Modell
„Superior 600“ den ersten Pkw-Zweitakt-Motor mit einer Benzindirekteinsprit-
zung ausgerüstet. Mercedes-Benz war mit dem „300 SL“ im Jahr 1954 Pionier bei
den Viertakt-Motoren. Zahlreiche technische Probleme verhinderten jedoch eine
Marktdurchdringung. Erst in den letzten Jahren ist die ottomotorische Direktein-
spritzung auch bei serienmäßigen Pkw zu finden. Dennoch hat sich die direkte
Einspritzung des Kraftstoffes in den Brennraum beim Ottomotor aufgrund der
engen Zündgrenzen als deutlich schwieriger darstellbar erwiesen als beim Diesel-
motor. Trotzdem besteht gerade beim direkteinspritzenden Ottomotor ein bedeu-
tendes Potenzial zur Senkung des Kraftstoffverbrauches, gerade in Verbindung
mit der Abgasturboaufladung.
Die Benzin-Direkteinspritzung ist ein Brennverfahren mit innerer Gemischbil-
dung. Die direkte Einbringung des Kraftstoffes führt innerhalb des Brennraumes
zu einem Entzug von Verdampfungswärme, sodass die Ladungsmasse erhöht wird
und die Zylinderladung bei Zündbeginn eine niedrigere Temperatur aufweist. Das
ermöglicht die Anhebung des Verdichtungsverhältnisses bei gleichbleibender
Klopfgrenze um 1-1,5 Einheiten und führt somit zu einer grundsätzlichen Wir-
kungsgradsteigerung im gesamten Motorkennfeld. Um den Motor auch im Teil-
lastbetrieb weitgehend ungedrosselt und daher mit annähernd konstanter La-
dungsmasse betreiben zu können, müssen mit sinkender Last höhere Luftverhält-
nisse bzw. eine Abmagerung des Gemisches erreicht werden. Das erfordert die
Zündung extrem magerer Gemische, was nur möglich ist, wenn innerhalb des
Brennraumes nahe der Zündkerze eine Ladungsschichtung erfolgen kann. Im
idealen Fall existiert nur im Bereich der Zündkerze ein stöchiometrisches Ge-
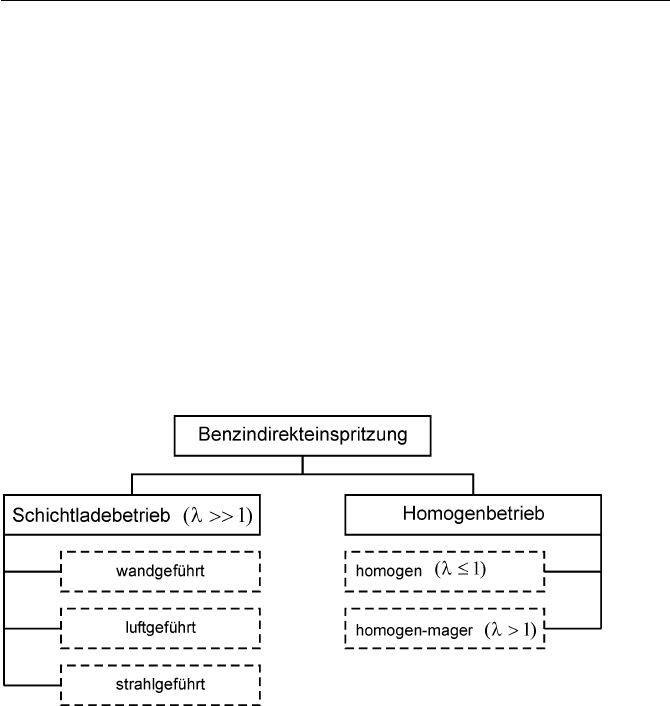
4.3 Gemischaufbereitung und Verbrennung 243
misch, und das Luftverhältnis nimmt mit zunehmendem Abstand von der Zünd-
kerze zu, bis an den Brennraumwänden nur noch reine Luft oder rückgeführtes
Abgas vorliegt.
Mit der Direkteinspritzung sind – im Gegensatz zur Saugrohreinspritzung –
mehrere Betriebsarten möglich, siehe Abb. 4.67
, die entsprechend des gewünsch-
ten Motorbetriebspunktes oder anhand funktionaler Anforderungen z.B. des Ab-
gasnachbehandlungssystems zum Einsatz kommen. Dabei handelt es sich um den
homogenen Betrieb, in dem innerhalb des gesamten Brennraumes ein homogenes
Kraftstoff-Luftgemisch vorliegt, und um den geschichteten oder Schichtlade-
Betrieb, bei dem sich zum Zündzeitpunkt nur im Bereich der Zündkerze eine si-
cher entflammbare Gemischwolke befindet, während im übrigen Brennraum sehr
mageres Gemisch vorhanden ist. Damit sind globale Luftverhältnisse bis
Ȝ = 10
möglich [ROB03a], die das Potenzial einer deutlichen Kraftstoffverbrauchssen-
kung bieten, jedoch nur einen Teillastbetrieb erlauben. Der übrige Brennraum ist
beim Schichtbetrieb entweder mit Luft, rückgeführtem Abgas oder sehr magerem
Gemisch gefüllt.
Abb. 4.67. Betriebsarten und Brennverfahren bei der Benzindirekteinspritzung
Das sehr hohe globale Luftverhältnis im Schichtladebetrieb führt aufgrund des
im Bereich der Brennraumwände niedrigen Temperaturniveaus – die Flamme
brennt infolge des extremen Luftüberschusses nicht so nah an die Wand heran –
zu geringeren Wandwärmeverlusten und zu einer signifikanten Entdrosselung des
Motors. Darüber hinaus wird mit der Direkteinspritzung ein Ladungswechsel mit
hohen Spülgraden möglich, ohne dass es – wie es bei der Saugrohreinspritzung
unumgänglich ist – zu einem Anstieg des Kraftstoffverbrauchs und der HC-
Emissionen infolge eines direkten Durchströmens von Gemisch in den Abgaska-
nal kommt. In Verbindung mit Aufladung sind weitere Verbesserungen durch die
Direkteinspritzung möglich.
Praktisch umgesetzt werden kann der Schichtladebetrieb durch das luftgeführte,
das wandgeführte und das strahlgeführte Brennverfahren. Während sich der Kraft-
stoff beim luft- und wandgeführten Verfahren weiter von der Zündkerze entfernt
mit der Luft vermischt und die Gemischwolke dann über eine gezielte Luftströ-

244 4 Relevante Subsysteme und Prozesse
mung (Drall oder Tumble) zur Zündkerze transportiert wird, erfolgt die Kraft-
stoffeinspritzung und Gemischbildung beim strahlgeführten Verfahren unmittelbar
in der Umgebung der Zündkerze. Je nachdem, welches Ausmaß die Kraftstoff-
wandanlagerung z.B. auf dem Kolben aufweist, erfolgt eine Differenzierung in die
Eigenschaft wand- oder luftgeführt. Infolge der Notwendigkeit zum Transport der
Gemischwolke in Richtung Zündkerze ist eine gerichtete Ladungsbewegung er-
forderlich, die u.a. durch eine spezielle Kolbenbodenform erzeugt wird. Diese
relativ zerklüftete Kolbenbodentopografie weist eine größere Oberfläche auf und
führt damit zu vergleichsweise hohen Wandwärmeverlusten. Das höhere Kolben-
gewicht wirkt sich zudem nachteilig auf Geräusch und Massenkräfte aus.
Das strahlgeführte Brennverfahren ist durch eine räumlich enge Anordnung von
Injektor und Zündkerze gekennzeichnet. Es gestattet höhere
Ȝ-Gradienten, eine
Ausweitung des Schichtbetriebs bei gleichzeitiger Steigerung der Systemrobust-
heit und ist weitgehend unabhängig vom Strömungsfeld innerhalb des Brennrau-
mes. Das Potenzial liegt in einer besonders schnellen Gemischbildung mit günsti-
ger Schwerpunktlage der Verbrennung, der Vermeidung von Wandbenetzung
sowie einem guten Ausbrand und einer hohen Verbrennungsstabilität über einen
erweiterten Kennfeldbereich. Damit sind neben einer weiteren Verbrauchssenkung
auch erheblich geringere HC-Emissionen als bei den luft- und wandgeführten
Verfahren möglich. Zum Strahlaufbruch und zur Gemischbildung stehen aller-
dings keine Drall- und Tumbleströmungen zur Verfügung, sondern nur der Strahl-
impuls in Verbindung mit aerodynamischen Kräften zwischen Tropfen und Um-
gebungsluft am Strahlrand. Zur Realisierung einer intensiven Gemischbildung
sind daher höhere Einspritzdrücke als beim luft- und wandgeführten Verfahren
erforderlich. Als sinnvoll werden Drücke von etwa 200 bar angesehen [ACH04],
mit denen eine gute Gemischaufbereitung mit kleinen Tropfendurchmessern dar-
gestellt werden können. Schwer zu realisieren ist die sehr präzise Strahlausrich-
tung und -führung sowie die Dauerhaltbarkeit der Zündkerze infolge einer ausge-
prägten Wärmewechselbelastung, die ihrerseits durch direkte Kraftstoffbenetzung
der heißen Zündkerze induziert wird, und eine höhere Ablagerungs- bzw. Verko-
kungsneigung an der Injektorspitze [PIO02]. Bisher ist das strahlgeführte Brenn-
verfahren in Serienmotoren noch nicht umgesetzt worden, es wird jedoch langfris-
tig das zielführende Verfahren der Ottodirekteinspritzung sein.
Der Homogenbetrieb lässt sich in die Bereiche homogen (
Ȝ 1) und homogen-
mager (
Ȝ > 1) aufteilen, wobei ersterer durch ähnliche Verhältnisse wie bei der
Saugrohreinspritzung charakterisiert ist. Der Homogen-mager-Betrieb erreicht
Luftverhältnisse bis etwa
Ȝ = 1,7. Ein Verfahren mit homogener Magerverbren-
nung für BDE-Ottomotoren stellt das sogenannte BPI-Verfahren (B
owl-
P
rechamber-Ignition) nach [LAT97] dar. Hauptmerkmal ist eine Doppeleinspritz-
strategie in Verbindung mit einer Vorkammerzündung. Durch Einspritzung einer
großen Kraftstoffmenge während des Ansaugtaktes wird ein homogen-mageres
Grundgemisch mit Ȝ = 1,5-1,7 erzeugt. Die zweite Einspritzung erfolgt während
des Verdichtungstaktes in Richtung der Kolbenmulde. Das Kraftstoffgemisch in
und über der Kolbenmulde wird mit der Kolbenbewegung in Richtung Vorkam-
merzündkerze bewegt, wobei am Ende der Kompressionsphase das Gemisch in-
folge der Druckdifferenz zwischen Brennraum und Vorkammer in diese hinein-
