Golloch R. Downsizing bei Verbrennungsmotoren: Ein wirkungsvolles Konzept zur Kraftstoffverbrauchssenkung
Подождите немного. Документ загружается.

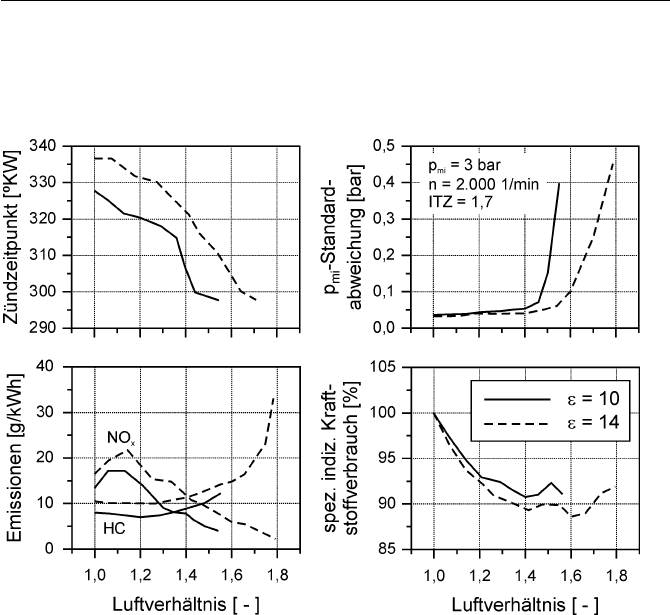
4.3 Gemischaufbereitung und Verbrennung 265
Hinsichtlich der NO
x
-Rohemissionen wirkt sich der Magerbetrieb aufgrund des
niedrigeren Temperaturniveaus positiv aus. Allerdings steigen die HC-Emissionen
infolge der nach spät verlagerten und zunehmend unvollständigeren Verbrennung
bei Luftverhältnissen über 1,4 deutlich an.
Abb. 4.83. Einfluss des Luftverhältnisses (Magerbetrieb) auf motorische Prozessgrößen
und Schadstoffemissionen [HAB99]
Bei Ottomotoren mit äußerer Gemischbildung muss die Ventilüberschneidung
begrenzt und auf das Spülgefälle abgestimmt werden, da sonst zu viel Frischge-
misch durch Kurzschlussspülung vom Einlasskanal direkt in den Auslasskanal
überströmt, was zu einer Verbrauchssteigerung führt und mit hohen HC-
Emissionen verbunden ist. Eine ausgeprägte Spülung des Brennraumes zur Ver-
meidung hoher Restgasanteile im Interesse einer hohen Motorleistung ist mit der
Saugrohreinspritzung daher nur sehr begrenzt möglich. Direkte Kraftstoffeinsprit-
zung bietet hier deutliche Vorteile. Hochaufladung erfolgt zweckmäßigerweise
durch Abgasturboaufladung oder durch mechanische Aufladung. Im Folgenden
sollen die Unterschiede zwischen diesen Aufladeverfahren in Bezug auf die moto-
rischen Prozessgrößen beschrieben werden. In Abhängigkeit der Wirkungsgrade
von Verdichter und Turbine, der Ventilsteuerzeiten sowie der Einstellungen für
die Turboladerregelung stellt sich ein Abgasgegendruck ein, der in Verbindung
mit dem Ladedruck einen wesentlichen Parameter für das Brennverfahren dar-
stellt.
Während bei der mechanischen Aufladung die Abgasseite weitgehend mit der
von Saugmotoren übereinstimmt und der Abgasgegendruck damit deutlich niedri-
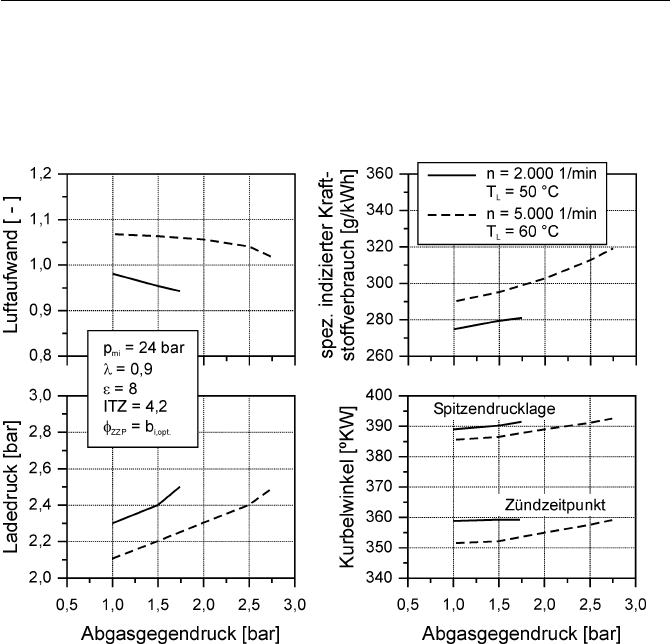
266 4 Relevante Subsysteme und Prozesse
ger ausfällt als bei der Abgasturboaufladung, können die Unterschiede zwischen
den beiden Aufladeverfahren anhand einer Variation des Abgasgegendruckes
relativ gut beschrieben werden. Abb. 4.84 zeigt den Einfluss des Abgasgegendru-
ckes auf den Kraftstoffverbrauch, den Luftaufwand sowie die Spitzendrucklage
und den Zündzeitpunkt für unterschiedliche Drehzahlen.
Abb. 4.84. Einfluss des Abgasgegendruckes auf motorische Prozessgrößen [HAB99]
Bei konstantem Mitteldruck steigen der Kraftstoffverbrauch und der erforderli-
che Ladedruck mit zunehmendem Abgasgegendruck an. Die Ursache liegt zum
einen in einer erhöhten Ladungswechselarbeit, da der Kolben die verbrannte Zy-
linderladung gegen den höheren Druck ausschieben muss. Andererseits führt der
steigende Abgasgegendruck zu einem sinkenden Luftaufwand, da sich die Rest-
gasausspülung verringert und die Rückkompression des Abgases vergrößert. In-
folge des höheren Gesamtwirkungsgrades ist bei der mechanischen Aufladung der
zur Darstellung eines bestimmten Mitteldruckes erforderliche Ladedruck trotzdem
höher als bei der Abgasturboaufladung. Die klopfbedingte Spätverstellung des
Zündwinkels wird durch den mit zunehmendem Abgasgegendruck steigenden
Restgasgehalt bewirkt und führt zu den bekannten Nachteilen hinsichtlich der
Verbrennungsstabilität. Aufgrund gasdynamischer Effekte steigt der Luftaufwand
mit zunehmender Drehzahl an, sodass der zur Darstellung des Mitteldruckes er-
forderliche Ladedruck trotz steigenden Verbrauchs abnimmt.
Der bei der Abgasturboaufladung infolge des höheren Abgasgegendruckes vor-
liegende hohe Restgasgehalt bewirkt eine stärkere Klopfneigung, längere Brenn-
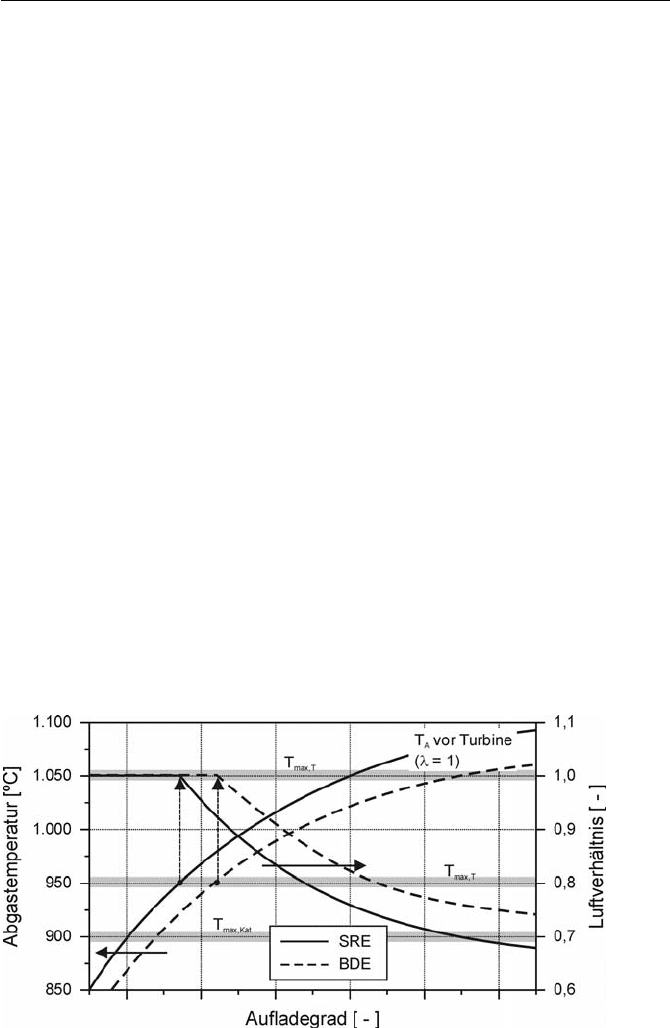
4.3 Gemischaufbereitung und Verbrennung 267
dauern. Das durch Abgasaufstau vor der Turbine höhere Druck- und Temperatur-
niveau führt zu deutlich höheren Abgastemperaturen im Vergleich zur mechani-
schen Aufladung und steigert damit die thermische Beanspruchung der abgasfüh-
renden Bauteile. Neben der maximal zulässigen Turbineneintrittstemperatur –
diese beträgt bei aktuellen Abgasturbinen ca. 950-980 °C – ist hierbei auch die
Katalysatoreintrittstemperatur maßgeblich, da im oberen Drehzahlbereich ein Teil
des Abgases über das Waste-Gate an der Turbine vorbei geleitet und direkt dem
Katalysator zugeführt wird. Für diesen Abgasteilstrom wirkt die Turbine daher
nicht temperatursenkend. Aufgrund des bei mechanischer Aufladung signifikant
höheren Spülgefälles im Vergleich zur Abgasturboaufladung steigt die Emission
unverbrannter Kohlenwasserstoffe infolge Kurzschlussspülung während der Ven-
tilüberschneidungsphase an. Hier kommt hinzu, dass das vor der Abgasturbine
wirkende höhere Temperaturniveau zu einer besseren Nachoxidation unverbrann-
ter Abgasbestandteile führt.
BDE-Konzepte
Wie bereits beschrieben, bietet die Benzindirekteinspritzung (BDE) gegenüber der
Saugrohreinspritzung prinzipiell beträchtliche thermodynamische Vorteile insbe-
sondere im Teillastbereich. Das größte Potenzial erschließt sich jedoch aus der
Kombination von Direkteinspritzung und Abgasturboaufladung, da sich beide
Verfahren ideal ergänzen und somit Synergieeffekte möglich sind. Aufgeladene
BDE-Ottomotoren ermöglichen im Vergleich zu den aufgeladenen SRE-Varianten
eine Anhebung der geometrischen Verdichtung um 1-2 Einheiten. Diese Maß-
nahme bewirkt eine Wirkungsgradsteigerung im gesamten Kennfeldbereich und
führt zu einem Verbrauchsvorteil im NEFZ von etwa 3-4% [WOL02]. Der Betrieb
bei höheren Verdichtungsverhältnissen reduziert die Abgastemperatur und damit
den Anfettungsbedarf zum thermischen Schutz von Abgasturbine bzw. Katalysa-
tor. In Abb. 4.85 ist dieser Sachverhalt schematisch dargestellt.
Abb. 4.85. Einfluss des Brennverfahrens und der zulässigen Abgastemperatur am Turbi-
neneintritt auf den Anfettungsbedarf [GOL04b]

268 4 Relevante Subsysteme und Prozesse
Mit zunehmendem Ladedruck bzw. Aufladegrad steigt die Abgastemperatur bei
stöchiometrischer Verbrennung degressiv an. Die Grenztemperatur des Katalysa-
tors beträgt etwa 900 °C. Aufgrund der höheren Verdichtung des BDE-Verfahrens
sind die Abgastemperaturen um etwa 30 K niedriger als beim SRE-Verfahren. Die
zur Einhaltung der maximalen Turbineneintrittstemperatur von 950 °C notwendi-
ge Gemischanreicherung ist daher beim BDE-Verfahren zu höheren Aufladegra-
den verschoben. Anders formuliert ist bei der BDE für einen bestimmten Auflade-
grad ein höheres Luftverhältnis zu realisieren mit entsprechenden, positiven Aus-
wirkungen auf den Kraftstoffverbrauch. Sofern die Turbine für eine Abgastempe-
ratur von 1.050 °C ausgelegt ist, wird eine Gemischanfettung erst bei deutlich
höheren Aufladegraden erforderlich. Ggf. bestimmt dann die Katalysatoreintritts-
temperatur das Ausmaß der Gemischanreicherung. In jedem Fall wirkt sich eine
gesteigerte, thermische Belastbarkeit der Abgasturbine positiv auf den Kraftstoff-
verbrauch aus.
Konventionelle, hochaufgeladene SRE-Ottomotoren weisen bei niedrigen
Drehzahlen aufgrund des unzureichenden Abgasenthalpieangebotes eine ausge-
prägte Drehmomentschwäche auf, die zur einer starken Beeinträchtigung der
Fahrbarkeit und damit der Kundenakzeptanz führt. Mit Hilfe der Direkteinsprit-
zung können hier durch die zusätzlichen Freiheitsgrade Ventilsteuerung und Ein-
spritzstrategie signifikante Verbesserungen im Low-End-Torque erzielt werden,
da grundsätzlich geringere Restriktionen hinsichtlich der Ventilüberschneidung,
Steuerzeiten und Einspritztiming bestehen und damit das Turboladerbetriebsver-
halten positiv beeinflusst werden kann.
Ein spülender Ladungswechsel, dargestellt durch eine lange Ventilüberschnei-
dungsphase, bewirkt beim aufgeladenen SRE-Motor eine Erhöhung sowohl des
Kraftstoffverbrauchs als auch der HC-Emissionen. Dieser Sachverhalt führt zu
einer steigenden thermischen Belastung des nachfolgenden Drei-Wege-
Katalysators, da ein Großteil des unverbrannten Gemisches dort exotherm umge-
setzt wird. Während die Ventilüberschneidung bei der Saugrohreinspritzung mit
Blick auf die Spülverluste begrenzt werden muss, kann sie bei der BDE mit dem
Ziel geringer Restgasanteile sowie niedriger Ladungstemperaturen deutlich erwei-
tert werden, sodass die Leistung infolge eines höheren Luftaufwandes über dem
gesamten Drehzahlbereich ansteigt und die Klopfgefahr weiter sinkt. Aufgrund
der verminderten Klopfempfindlichkeit kann der vorverlegt werden, sodass so-
wohl das Volllastmoment als auch der Wirkungsgrad ansteigen.
Der höhere Wirkungsgrad von aufgeladenen BDE-Motoren erfordert zur Dar-
stellung gleicher Leistung eine geringere Luftmenge, sodass sowohl der Verdich-
ter als auch die Turbine kleiner ausgeführt sein können. Das ermöglicht ein besse-
res Transientverhalten des Motors. Eine große Spülmenge bewirkt zudem eine
Erhöhung des durch die Turbine geleiteten Massenstroms und ermöglicht damit
höhere Ladedrücke sowie ein besseres dynamischen Ansprechverhaltens durch
steigende Turbinenleistung. Da im Verdichter infolge der Spülung ebenfalls mehr
Frischluft durchgesetzt wird, entfernen sich die Betriebspunkte von der Pump-
grenze und stabilisieren den Verdichterbetrieb [PRE02]. Die Direkteinspritzung
bei Hochaufladung erlaubt somit die Kombination von attraktiven spezifischen
Leistungen mit hohen Mitteldrücken bei niedrigen Drehzahlen. [LAN03b] und
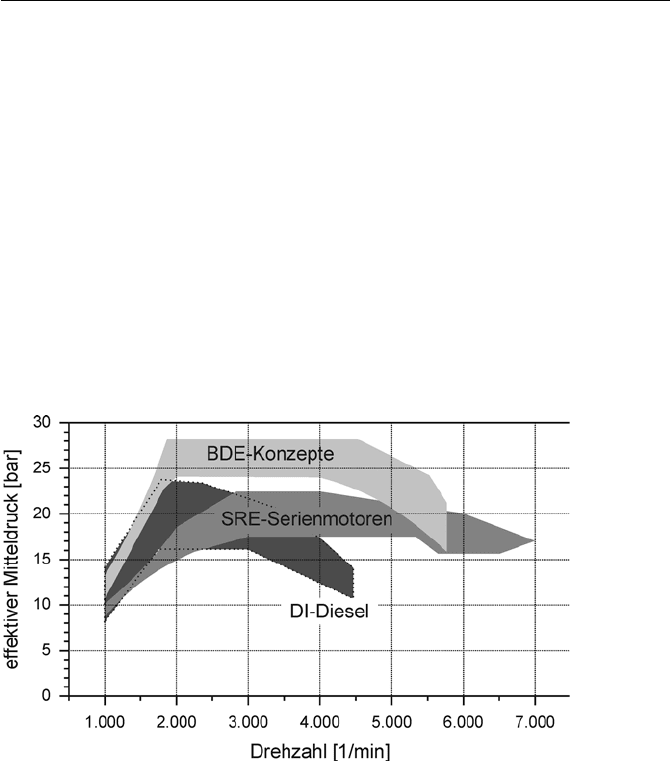
4.3 Gemischaufbereitung und Verbrennung 269
[BEE03] geben für das Anfahrdrehmoment eines aufgeladenen BDE-Motors mit
Nockenwellenverstellung eine 20%-ige Steigerung gegenüber der aufgeladenen
SRE-Variante mit festen Steuerzeiten an.
Abbildung 4.86 zeigt einen Vergleich des Drehmomentverlaufes aktueller, auf-
geladene SRE-Ottomotoren mit turboaufgeladenen Hochlast-BDE-Konzepten und
modernen Dieselmotoren. Neben einer deutlichen Steigerung des Volllast-
Drehmomentes können bei gleicher oder höherer spezifischer Leistung vor allem
das Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen sowie das Transientverhalten signifi-
kant verbessert werden. Infolge dessen bildet die Direkteinspritzung mit Turboauf-
ladung die ideale Basis für verbrauchssenkende Downsizing-Konzepte, da neben
der Lastpunktverschiebung auch eine durch das höhere Low-End-Torque mögli-
che, verlängerte Achsübersetzung zur Wirkungsgradsteigerung genutzt werden
kann. Die hohen, im Volllastbereich in den Brennraum eingespritzten Kraftstoff-
mengen dürfen jedoch nicht den Kolben oder die Zylinderwand benetzen, damit
eine erhöhte HC-Emission sowie eine zunehmende Ölverdünnung vermieden
werden kann.
Abb. 4.86. Vergleich verschiedener Motorkonzepte mit Abgasturboaufladung [FRA03]
Mit Hilfe der Direkteinspritzung ist zudem eine gezielte Beeinflussung der
Gemischbildung sowie des Brennverlaufs möglich, da prinzipiell alle Arbeitstakte
für die Einspritzung zur Verfügung stehen. Für die Hauptverbrennung kann die
Einspritzung auf den Ansaug- und den Verdichtungstakt verteilt werden. Damit
erfolgt eine Anhebung des Liefergrades sowie eine Reduzierung der Klopfemp-
findlichkeit. Darüber hinaus bietet eine Einspritzung während des Expansions-
und Ausschiebetaktes die Möglichkeit einer gezielten Beeinflussung der Abgas-
temperatur und damit der Turbinenleistung sowie des Katalysatorbetriebsverhal-
tens. So bewirkt z.B. eine späte Nacheinspritzung kurz nach dem Start eine Ver-
kürzung des Katalysator-Light-Off durch hohe Abgastemperaturen, sodass die
thermische Trägheit des Abgasturboladers weitgehend kompensiert werden kann.
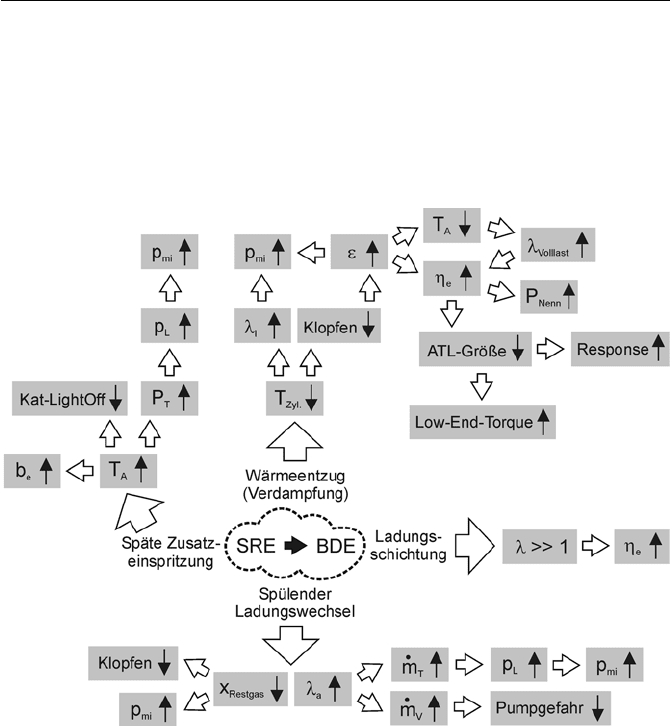
270 4 Relevante Subsysteme und Prozesse
Da innerhalb des Warmlaufs ein Großteil der zyklusrelevanten Schadstoffemissio-
nen entstehen, ist diese Maßnahme durchaus vielversprechend. Bezüglich einer
spürbaren Drehmomentsteigerung im Instationärbetrieb durch eine späte Teilein-
spritzung bestehen nach [SEN04] nur geringe Potenziale. Abb. 4.87 fasst noch
einmal die möglichen und größtenteils nutzbaren Vorteile der Benzindirektein-
spritzung gegenüber der Saugrohreinspritzung zusammen, ohne einen Anspruch
auf Vollständigkeit stellen zu wollen.
Abb. 4.87. Vorteile der Benzindirekteinspritzung gegenüber der Saugrohreinspritzung
Direkteinspritzende, aufgeladene Ottomotoren bieten hinsichtlich des Brenn-
verfahrens in der Summe deutlich mehr Freiheitsgrade als klassische Saugrohrein-
spritzer. Prinzipiell sind sowohl stöchiometrische Konzepte als auch Magerkon-
zepte mit oder ohne Schichtladung darstellbar.
Stöchiometrische Konzepte
Der Motorbetrieb mit einem Luftverhältnis von Ȝ = 1 kann mittelfristig als der
sinnvollste Weg zur Darstellung eines ottomotorischen Downsizing-Konzeptes
angesehen werden, da er die prinzipbedingten Vorteile der Direkteinspritzung zu
großen Teilen ausnutzt und darüber hinaus die Verwendung eines geregelten 3-
Wege-Katalysators zur Abgasnachbehandlung erlaubt. Damit ist die Einhaltung
der gesetzlich limitierten Schadstoffkomponenten sehr zuverlässig und ohne wei-

4.3 Gemischaufbereitung und Verbrennung 271
teren Aufwand möglich. Das Gesamtsystem kann damit vergleichsweise kosten-
günstig und zuverlässig ausgeführt werden.
Zur Darstellung eines stöchiometrischen Betriebs sind Konzepte ohne und mit
AGR möglich. Die klassische Variante ohne AGR erreicht höchste Mitteldrücke.
Während die Laststeuerung im Teillastbereich durch Drosselung oder variabler
Ventilsteuerung erfolgt, kann im Nennleistungsbereich auf eine Gemischanreiche-
rung zum thermischen Bauteilschutz in der Regel jedoch nicht verzichtet werden,
da die thermodynamischen Vorteile durch Gemischkühlung mit zunehmender
Drehzahl stetig sinken und die Verbrennung durch längere Einspritzdauern nach
spät verlagert werden (Gemischbildung läuft unvollständiger ab und die Abgas-
temperatur steigt). Je nach Auslegung der Einspritzkomponenten kann der negati-
ve Einfluss zu langer Einspritzdauern die Vorteile der Innenkühlung überkompen-
sieren [SPI02]. Zur Realisierung einer hohen Nennleistung müssen demnach die
Einspritzzeiten kurz gehalten werden, was sich grundsätzlich durch Erhöhung des
hydraulischen Einspritzventildurchsatzes sowie durch höhere Einspritzdrücke
realisieren lässt. Hieraus wird deutlich, dass sich Hochlast- und Hochleistungs-
konzepte einspritzseitig nicht ohne weiteres mit einem im unteren Kennfeldbe-
reich arbeitenden Schichtladebetrieb verbinden lassen, da der Motorbetrieb mit
Schichtladung andere Anforderungen an das Einspritzsystem stellt als der Betrieb
bei hohen Motorlasten.
Die weltweit ersten Anbieter von großserientauglichen Motoren mit Benzindi-
rekteinspritzung (als Homogenkonzept) und Aufladung waren DaimlerChrysler
und Audi. Während DaimlerChrysler einen mechanisch aufgeladenen BDE-Motor
(1,8-R4, BDE, Kompressor) anbietet, bevorzugt Audi die Kombination von Di-
rekteinspritzung und Abgasturboaufladung (2,0-R4, BDE, ATL). Der Audi-Motor
verwendet Drall-Einspritzventile und Muldenkolben. Letztere ermöglichen eine
länger andauernde, kugelförmige Ausbreitung der Flammenfront sowie eine Stabi-
lisierung der vergleichsweise ausgeprägten Tumble-Strömung. Als Ergebnis kann
eine reduzierten Klopfneigung und ein schnelleres Durchbrennen der Zylinderla-
dung beobachtet werden [WUR04b].
Die auch bei hohen Ladungsmengen intensive Gemischhomogenisierung durch
die erhöhte Ladungsbewegung gestattet darüber hinaus günstige (frühe) Verbren-
nungsschwerpunktlagen und wirkt sich somit positiv auf den Kraftstoffverbrauch
und die
p
mi
-Standardabweichung als Maß für die Laufruhe des Motors aus. Durch
den höheren Wirkungsgrad des BDE-Motors im Vergleich zum SRE-Motor kön-
nen gleiche Drehmomente mit reduziertem Ladedruck und geringeren Luft- und
Kraftstoffmassen erreicht werden. Dies bietet Potenzial zur Reduzierung der Bau-
größe des Abgasturboladers, sodass sich sowohl das Low-End-Torque als auch
das Beschleunigungsverhalten signifikant verbessert. Abb. 4.88 zeigt diesen Sach-
verhalt in Form eines Vergleichs mit einem leistungsgleichen SRE-Turbomotor
(Motorhubvolumen skaliert).
Das hohe Verdichtungsverhältnis, die günstigeren Verbrennungslagen sowie
das schnelle Durchbrennen des Gemisches führen zu einer Steigerung der Zylin-
derspitzendrücke im Vergleich zum turboaufgeladenen Saugrohreinspritzer. Bei-
spielsweise erreicht der BDE-Turbomotor von Audi maximale Zylinderdrücke von
125 bar, während der konzerneigene SRE-Turbomotor höchstens 110 bar erreicht.
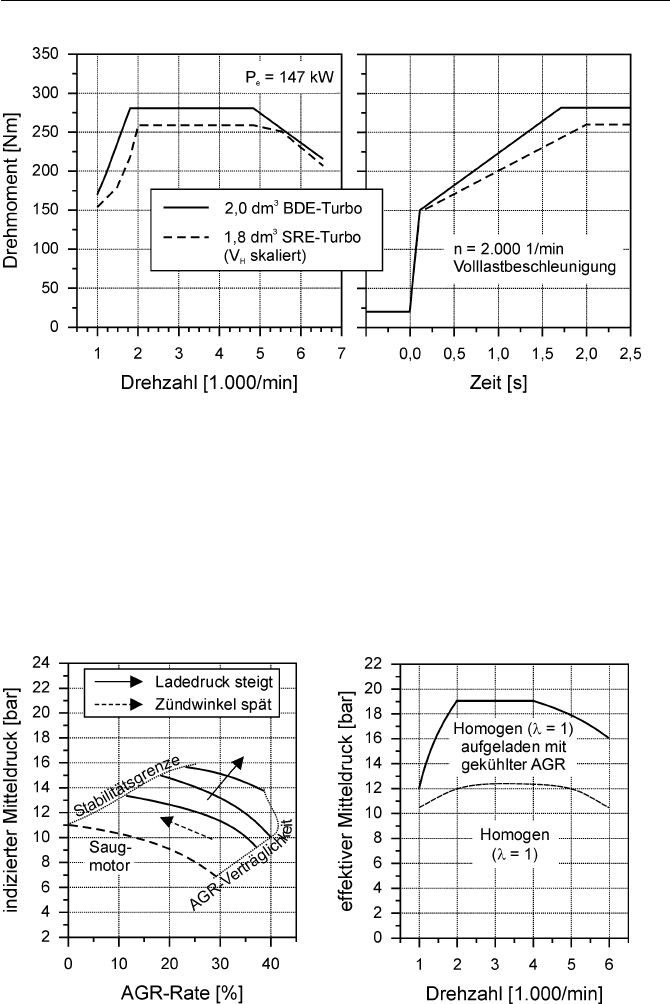
272 4 Relevante Subsysteme und Prozesse
Abb. 4.88. Vergleich von SRE-Turbo und BDE-Turbo hinsichtlich stationärem Volllast-
Drehmoment und Volllast-Beschleunigung [WUR04b]
Die zweite Variante eines stöchiometrischen Motorbetriebs mit Direkteinsprit-
zung erfordert im Hochlastbereich den Einsatz gekühlter, externer Abgasrückfüh-
rung, um auf die Gemischanreicherung verzichten zu können, siehe Abb. 4.89.
Infolge des bei der Abgasturboaufladung im Vergleich zur mechanischen Aufla-
dung deutlich höheren Abgasgegendruckes sind relativ hohe AGR-Raten darstell-
bar. Im Teillastbetrieb ermöglichen hohe AGR-Raten geringere Ladungswechsel-
verluste.
Abb. 4.89. Stöchiometrisches Brennverfahren mit Direkteinspritzung, Abgasturboaufla-
dung und Abgasrückführung (EBDI) der Fa. Ricardo [LAK04]
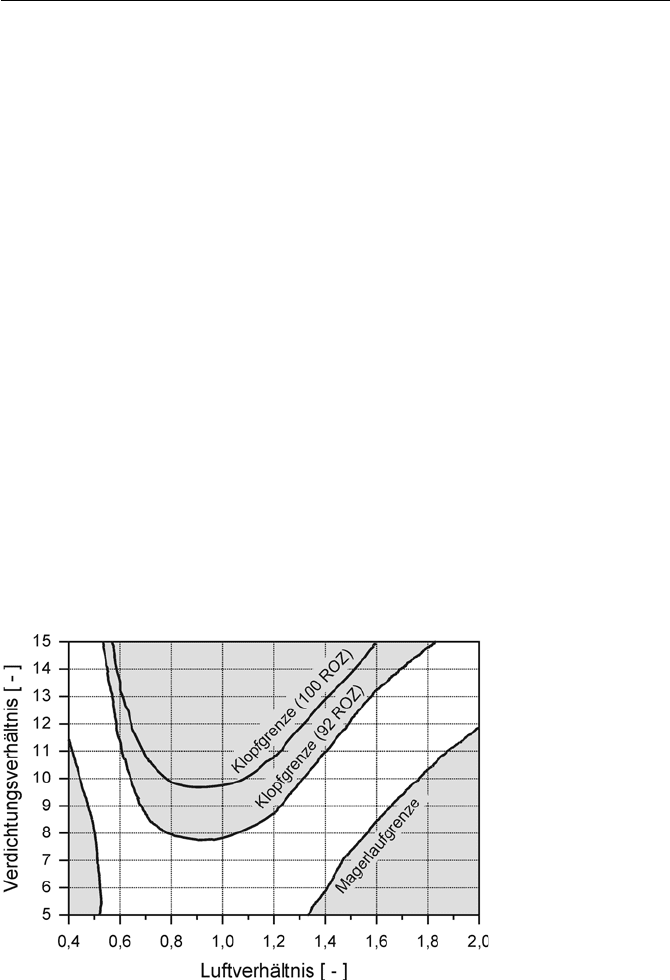
4.3 Gemischaufbereitung und Verbrennung 273
Steigende Restgasanteile führen zwar zu sinkenden Mitteldrücken, verringern
jedoch die Klopfempfindlichkeit, sofern das Abgas gekühlt zugeführt wird. Durch
Aufladung und intensive Ladungsbewegung kann die AGR-Verträglichkeit erhöht
werden, sodass der erreichbare Mitteldruck trotz hoher AGR-Raten ansteigt. Auf-
grund der gekühlten Abgasrückführung mit hohen Restgasanteilen ist die Abgas-
temperatur vergleichsweise niedrig, sodass auf die Gemischanfettung im Nenn-
leistungsbereich weitgehend verzichtet werden kann. Die geringere Klopfempfind-
lichkeit erlaubt zudem die Anhebung der geometrischen Verdichtung. Der zusätz-
liche Aufwand zur Abgasentnahme, -kühlung und –zuführung ist jedoch sehr
kostenintensiv, zumal es eine große Herausforderung darstellt, die hohen AGR-
Raten über den gesamten Drehzahlbereich zur Verfügung zu stellen [LAK04].
Mager-Konzepte
Brennverfahren, die eine überstöchiometrische Gemischzusammensetzung erlau-
ben, bieten grundsätzlich thermodynamische Vorteile. Das geringere Temperatur-
niveau reduziert die Klopfneigung sowie die Wandwärmeverluste und führt zu
geringeren thermischen Beanspruchungen der mit der heißen Zylinderladung in
Kontakt kommenden Bauteile wie z.B. Abgasturbine und Katalysator. Aufgrund
der durch den Magerbetrieb deutliche verringerten Klopfneigung kann das geo-
metrische Verdichtungsverhältnis angehoben werden. Nachteilig ist das zur Dar-
stellung hoher Mitteldrücke erforderliche hohe Ladedruckniveau sowie die Not-
wendigkeit zur nachmotorischen NO
x
-Reduzierung mit Hilfe eines zusätzlichen
DENOX-Katalysators. Der Magerbetrieb kann zum einen homogen und zum an-
deren mit geschichteter Ladung erfolgen. In der Praxis wird ein überstöchiometri-
scher Betrieb nur in Kombination mit der direkten Kraftstoffeinspritzung möglich
sein, da hierdurch mehr Freiheitsgrade zur Verfügung stehen.
Abb. 4.90. Einfluss der Kraftstoffzusammensetzung und der Oktanzahl auf den Homogen-
betrieb des Ottomotors [GRU79]
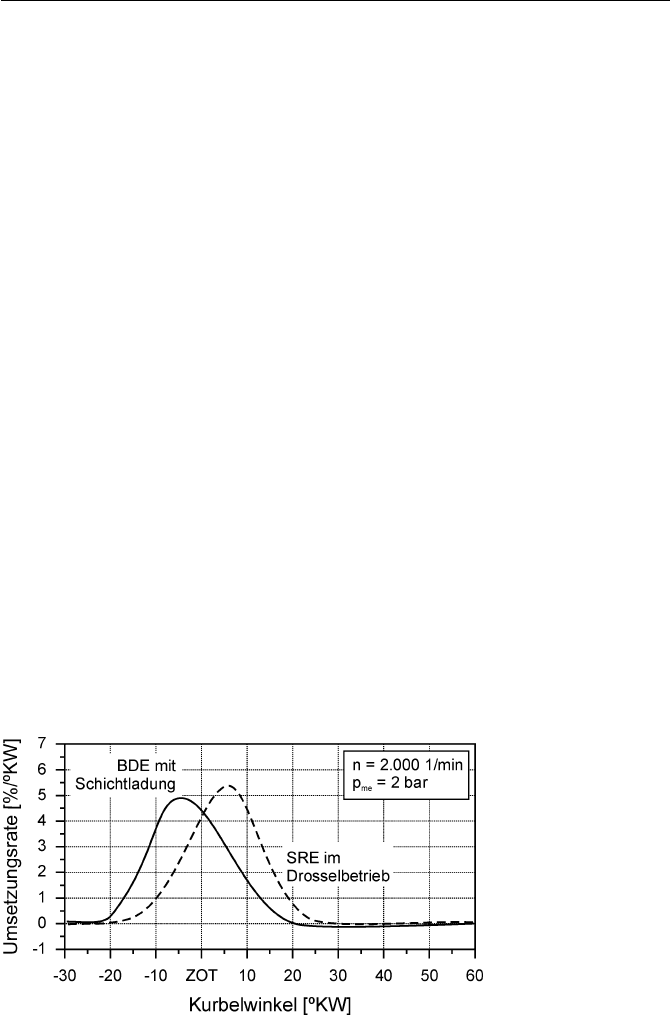
274 4 Relevante Subsysteme und Prozesse
Bei der Verwendung von Ottokraftstoff treten die höchsten Reaktionsge-
schwindigkeiten etwas unterhalb von
Ȝ = 1 auf. Sehr magere oder fette Gemische
reagieren langsamer und ermöglichen damit den Betrieb mit höheren geometri-
schen Verdichtungsverhältnissen. Die in Abb. 4.90 skizzierten Bereiche, in denen
ein klopffreier Motorbetrieb mit sicherer Entflammbarkeit des Gemisches möglich
ist, sind bei aktuellen Motoren um etwa 3 Einheiten zu höheren Verdichtungsver-
hältnissen verschoben. Die Grafik zeigt jedoch sehr anschaulich, welche Abhän-
gigkeiten zwischen den Parametern bestehen, und besitzt daher nach wie vor qua-
litative Gültigkeit.
Im Teillastbetrieb trägt die Abgasrückführung einen beträchtlichen Anteil zur
Verbrauchssenkung direkteinspritzender Ottomotoren bei. Hiermit lassen sich die
maximalen Verbrennungstemperaturen absenken und führen damit zu einer deutli-
chen Reduzierung der NO
x
-Rohemissionen. Infolge der dadurch für den Fall einer
mageren Verbrennung verminderten Regenerationshäufigkeit des NO
x
-Speicher-
katalysators ergibt sich zusätzlich eine Kraftstoffverbrauchssenkung. Die Erhö-
hung der AGR-Verträglichkeit leistet damit einen wichtigen Beitrag im Rahmen
der Entwicklung moderner BDE-Konzepte. Um den bei hohen AGR-Raten auftre-
tenden, negativen Begleiterscheinungen wie schlechtere Entflammungs- und
Verbrennungsbedingungen sowie einem Anstieg von Verbrauch, HC-Emissionen
und Laufunruhe entgegentreten zu können, sind auch Verfahren einer „geschichte-
ten Abgasrückführung“ im Gespräch. Hierbei erfolgt eine gezielte Schichtung des
rückgeführten Abgases im Zylinder mit dem Ziel möglichst geringer Abgaskon-
zentrationen im Zündkerzenbereich zur Verbesserung der Entflammungsbedin-
gungen [PET04]. Um die erhöhten AGR-Raten zuführen zu können und die Ab-
gastemperatur mit Blick auf die Temperatur vor Katalysator anzuheben (
Ȝ sinkt,
Brenndauer verlängert sich), ist beim geschichtet betriebenen Motor eine Andros-
selung der Ansaugluft erforderlich.
Die bei der mittels luft- oder wandgeführten Verfahren realisierte Benzindirekt-
einspritzung führt im Schichtladebetrieb zu einer charakteristischen frühen
Schwerpunktlage der Verbrennung (vor dem oberen Totpunkt), siehe Abb. 4.91.
Abb. 4.91. Brennverlauf für konventionelle Drosselsteuerung und BDE mit Schichtladung
im Teillastbetrieb [GRE99]
