Klein B. FEM: Grundlagen und Anwendungen der Finite-Element-Methode im Maschinen - und Fahrzeugbau
Подождите немного. Документ загружается.

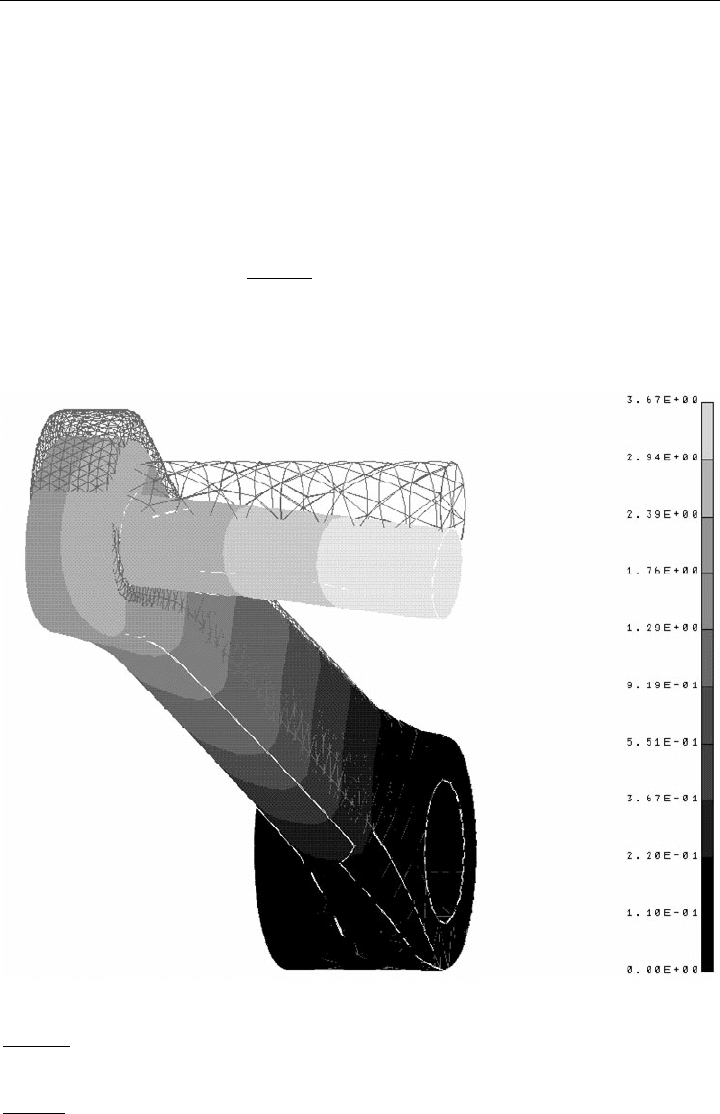
Fallstudie 7: zu Kapitel 7.5 Anwendung der Volumen-Elemente
338
Diese Elemente werden in modernen FE-Systemen bei automatischen Meshprozeduren, dem
so genannten free meshing, üblicherweise verwendet. Für eine realistische Modellbildung
der Krafteinleitung war es notwendig, ein Stück des Pedalbolzens zu berücksichtigen.
Damit ein möglichst durchschnittliches Fahrerspektrum abgedeckt werden kann, wurde als
maximale Fußkraft N000.1F
z
gewählt. Das erzeugte Drehmoment wird dann über einen
Vierkant in das Kettenblatt eingeleitet. Da bei der Analyse nur die Augenblicksstellung der
ungünstigsten Krafteinleitung betrachtet wird, kann für die Anbindung an das Vierkantprofil
eine feste Einspannung mit u = 0, v = 0 und w = 0 angenommen werden.
Unter diesen Vorgaben ist im Bild 7.3 zunächst die elastische Verformbarkeit der Kurbel
ausgewertet worden. Es ist erkennbar, dass insbesondere im vorderen Bereich die Knoten
translatorisch und rotatorisch ausgelenkt werden. Die Kurbel muss daher eine ausreichende
Torsions- und Biegesteifigkeit aufweisen.
Bild 7.3: Deformation der Tretkurbel bei Belastung
Im weiteren Interesse ist noch abzuklären, ob die Beanspruchung in der Kurbel zulässig ist.
Bild 7.4
zeigt die entsprechende Spannungsauswertung über Isolinien.

Fallstudie 7: zu Kapitel 7.5 Anwendung der Volumen-Elemente
339
Wie zu erwarten war, nehmen die Spannungen zu bzw. verdichten sich an den Randbe-
dingungsstellen. Ausgewertet wurden dabei die Vergleichsspannung
¸
¹
·
¨
©
§
WWWVVVVVVVVV V
2
xz
2
yz
2
xyzxzyyx
2
z
2
y
2
xV
3 (1)
nach von Mises.
Bild 7.4:
Spannungsverteilung in der Tretkurbel bei Belastung
Die Spannungen sind aber nicht kritisch, da im Gesenk geschmiedete Al-Legierungen
Streckgrenzenwerte von 200-420
2
N/mm aufweisen.
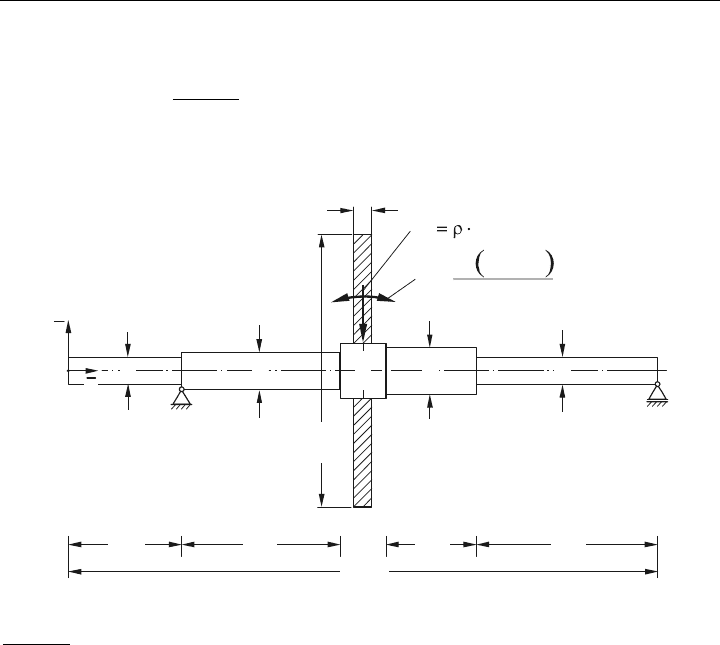
340
Fallstudie 8: zu Kapitel 9 Dynamische Probleme
Die nachfolgend im Bild 8.1 dargestellte Welle wird in einer Kartonagenmaschine zum
Schneiden von Pappkartons eingesetzt. Um den Schneidevorgang sauber ausführen zu kön-
nen, sollen die Eigenfrequenzen und Eigenformen dieser Welle berechnet werden.
1300
250 350 200 400100
y
x
Ø120
Ø100
Ø60
Ø60
Ø80
Ø600
40
mV
T
mr t3
12
22
3
26
mg/dk81,7
m/mN101,2E
U
Bild 8.1: Schneidwelle für Kartonagenmaschine
Wie im Kapitel 9.4 dazu ausgeführt worden ist, gilt es in diesem Fall, das Eigenschwin-
gungsproblem
0UKÜM (1)
der Biegung zu lösen. Die Dämpfung ist hierbei vernachlässigt worden, da keine sinnvollen
Werte ermittelbar sind.
Für die Idealisierung wählen wir zweckmäßigerweise 2-D-Balken-Elemente. Des Weiteren
bauen wir das Schneidenblatt mit seiner Masse und seinem Massenträgheitsmoment, so wie
im Kapitel 9.2.2 gezeigt, an den entsprechenden Knoten der darunter liegenden Balken-Ele-
mente ein. Das so aufbereitete System ist dann mit dem FEM-Paket I-DEAS mithilfe des
Lanczos-Algorithmus dynamisch durchgerechnet worden.
Bei diesem Berechnungsverfahren müssen, im Gegensatz zu weniger effektiven Lösungsver-
fahren, keine möglichen Vorzugsrichtungen vordefiniert werden. Das Programm untersucht
das ganze FE-Modell selbstständig auf alle vorkommenden Eigenformen. Dadurch ist ge-
währleistet, dass keine Eigenfrequenzen bzw. deren zugehörige Eigenformen vom Bediener
übersehen werden.

Fallstudie 8: zu Kapitel 9 Dynamische Probleme
341
Die Eigenfrequenzen konnten so gefunden werden zu:
Z
1
1
66,34
s
#
n
1
3980,4 1
/min
Z
2
1
250,95
s #
n
2
15057 1 /min
Z
3
1
568,35
s #
n
3
34101 1
/min
Z
4
1
781
,87 s #
n
4
46912,2 1 /min
Z
5
1
817,16
s
#
n
5
49029,6 1 /min
Wir wissen, dass man ein Maschinenelement nie mit seinen Eigenfrequenzen anregen sollte,
da es so zerstört würde. Um also die zulässigen Betriebsbereiche vor Augen zu haben, zeich-
nen wir uns das Frequenzband auf. Hierin ist sofort zu erkennen, welche Betriebszustände
möglich sind, welche Eigenfrequenzen dazu durchfahren werden müssen und wie der Ab-
stand zu den nächstliegenden Anregungen ist. Bei den meisten Anwendungen wird die hier
betrachtete Welle auf Grund der Höhe der Frequenzen nur in der ersten Eigenfrequenz auf
kritische Anregung untersucht werden müssen.
Z
1
Z
Z
Z
Z
Z
(s )
-
1
n (min )
-1
n
1
n
2
n
3
n
4
n
5
5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000
Bild 8.2:
Frequenzband der Schneidwelle
Die sich dabei einstellenden Eigenfrequenzen zeigt das nächste Bild 8.3
. Das Messerblatt
zum Kartonschneiden befindet sich dabei auf der Knotenposition Nr. 14. Aus den Eigen-
formen lässt sich dann mit Bezug auf die dazugehörenden Frequenzen eine Aussage über die
Qualität der im Betrieb entstehenden Schneidkante machen.
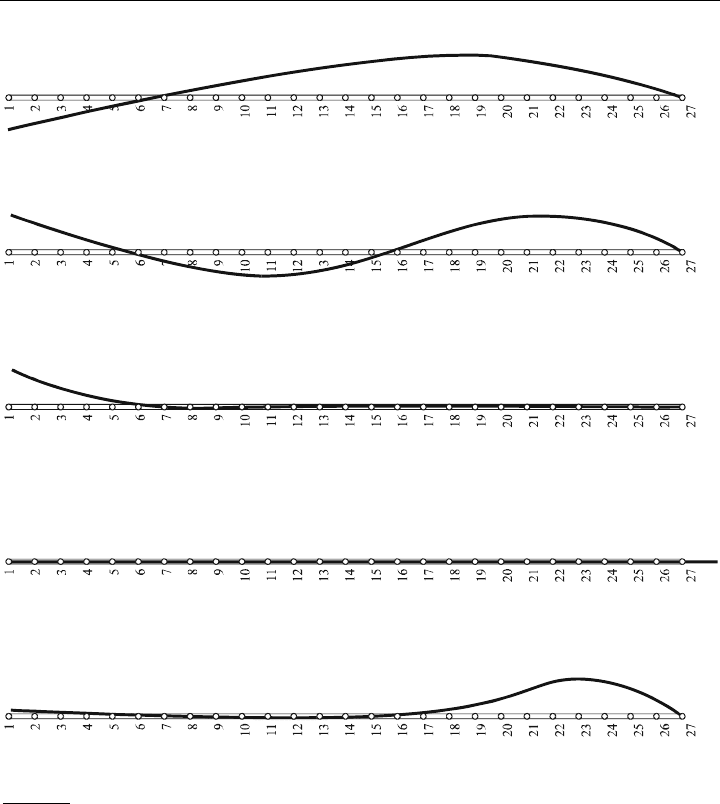
Fallstudie 8: zu Kapitel 9 Dynamische Probleme
342
Mode Number 1: 66,34 Hz
Mode Number 2: 250,95 Hz
Mode Number 3: 568,35 Hz
Mode Number 4: 781,87 Hz
Mode Number 5: 817,16 Hz
Bild 8.3:
Erste fünf Eigenschwingungsformen der Schneidwelle

343
Fallstudie 9: zu Kapitel 9.6 Erzwungene Schwingungen
Im Folgenden soll eine aus Volumen-Elementen aufgebaute Stimmgabel als repräsentatives
Beispiel für eine erzwungene Schwingung behandelt werden. Die Kraft soll durch einen
kurzen Schlag auf einen Zinken als Impuls P = 100 N für die Dauer von 1 ms aufgebracht
werden. Danach soll die Stimmgabel frei ausschwingen. Mittels einer dynamischen FEM-
Analyse wollen wir im Weiteren die Eigenschwingungsformen und das Ausschwingverhal-
ten der Stimmgabel ermitteln.
Das Eigenverhalten des Modells erhält man aus der Lösung der homogenen DGL der freien
Schwingungen
0UKÜM
(1)
bzw. dem zugehörigen Eigenwertproblem. Die Eigenformen werden mit einer Modalanalyse
nach der Block-Lanczos-Methode ermittelt. Die Auswertung wird auf die ersten acht Eigen-
frequenzen und Eigenschwingungen beschränkt. Diese sind im Bild 9.1 dargestellt. Die erste
Eigenform (x-Richtung) hat eine Eigenfrequenz von 148,96 Hz. Die zweite Eigenform
(152,19 Hz) ist orthogonal zur ersten gerichtet. Die dritte Eigenform wird durch Torsion der
Zinken gegeneinander erzeugt. Sie tritt mit höherer Frequenz (296,36 Hz) auf. Die weiteren
ermittelten Eigenformen basieren auf den ersten dreien, weisen aber höhere Ordnungen auf.
In der nächsten Betrachtung bringen wir den Schlag am Ende eines Zinkens in x-Richtung
auf und berechnen in Zeitschritten von 0,0001 Sekunden das Schwingungsbild. In der tran-
sienten Analyse wird die Folgende inhomogene DGL mit Kraftanregung gelöst:
tPUKUCÜM
. (2)
Der Schlag ist quantifiziert durch
.0ttP
,N100ms1tP
,00P
1
1
!
dd
tt
t
0
0
Da Ausschwingen erfolgen soll, berücksichtigen wir noch zusätzlich mit
KC 0001,0 (3)
0,01 % Strukturdämpfung. Am Bildschirm beobachten wir, dass vom Zeitpunkt
0
t aus-
gehend die Stimmgabel in x-Richtung mit der Amplitude u ausgelenkt wird und nach 0,1 s
bereits eine deutliche Abnahme der Amplitude festzustellen ist. Hierbei wurde im Wesent-
lichen die erste Eigenfrequenz angeregt.
Der Verlauf der Amplitude am Lastangriffspunkt ist im Bild 9.2
dargestellt.
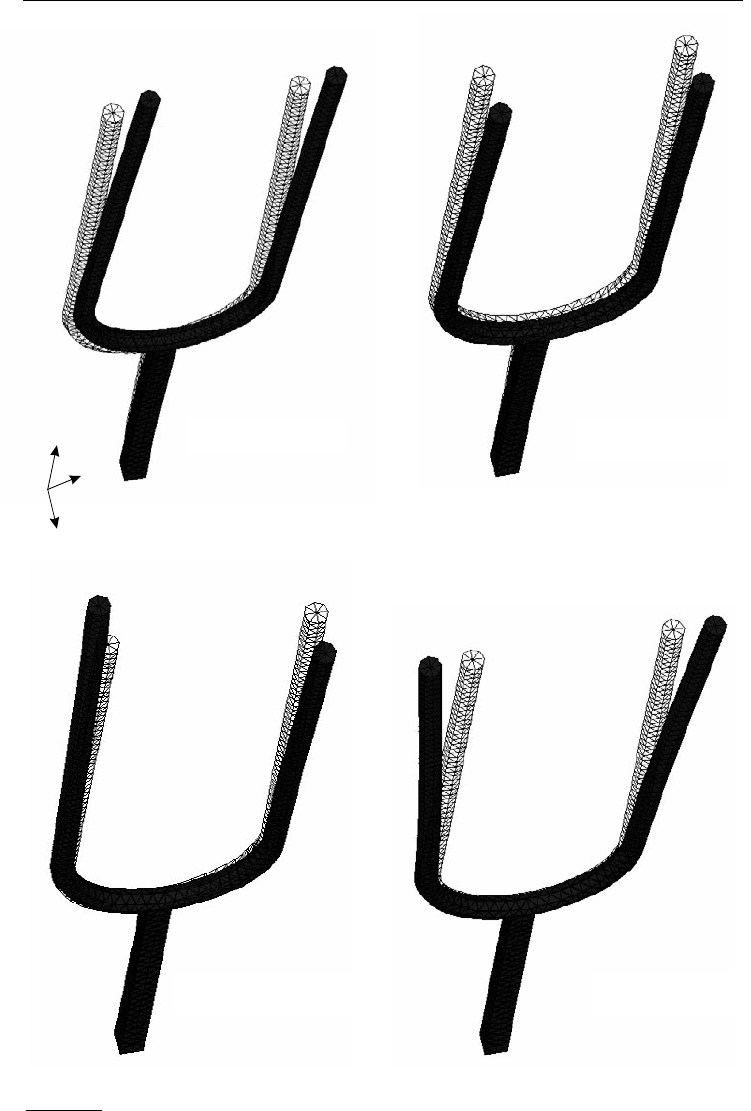
Fallstudie 9: zu Kapitel 9.6 Erzwungene Schwingungen
344
Bild 9.1a:
Die ersten vier Eigenschwingungsformen der Stimmgabel
1
n
= 148,96 Hz
2
n = 152,19 Hz
4
n = 312,94 Hz
3
n = 296,39 Hz
x
z
y
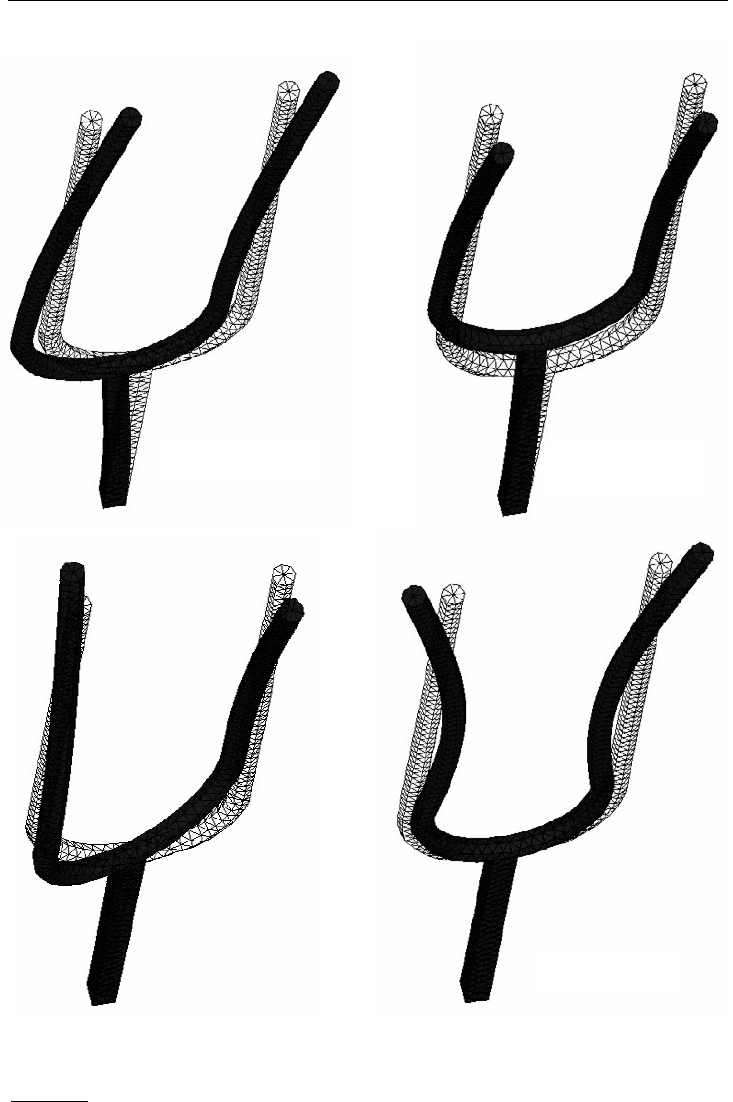
Fallstudie 9: zu Kapitel 9.6 Erzwungene Schwingungen
345
Bild 9.1b:
Die fünfte bis achte Eigenschwingungsform der Stimmgabel
5
n = 901,80 Hz
6
n = 930,54 Hz
7
n = 1183 Hz
8
n = 1880 Hz
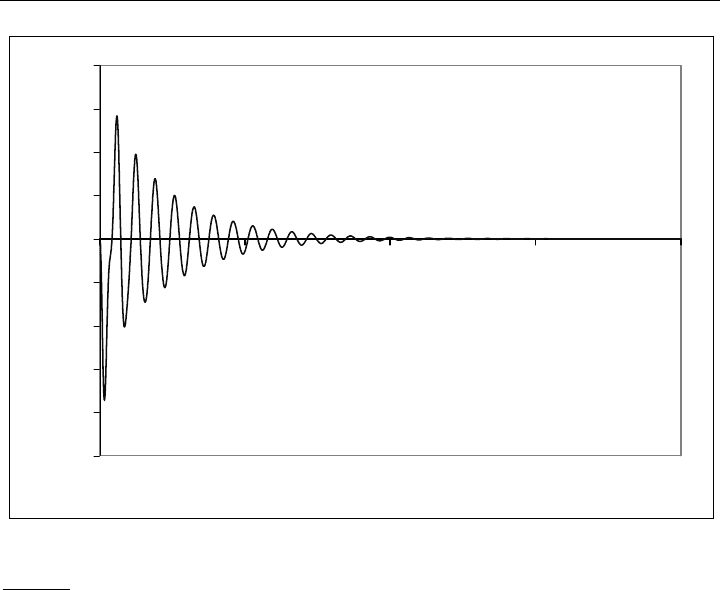
Fallstudie 9: zu Kapitel 9.6 Erzwungene Schwingungen
346
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
0 0,05 0,1 0,15 0,2
t (s)
u
x
(mm)
Bild 9.2: Zeitverlauf der Amplitude in x-Richtung
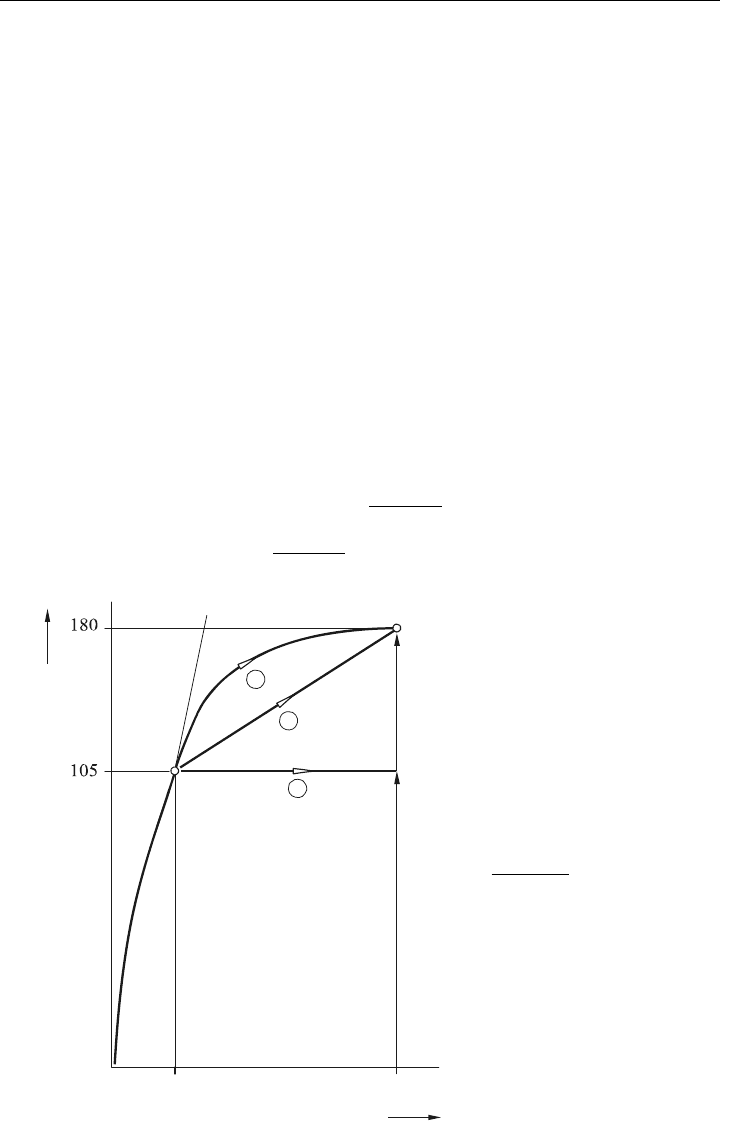
347
Fallstudie 10: zu Kapitel 10 Materialnichtlinearität
In den vorausgegangenen Beispielen sind alle Verformungen und Spannungsverläufe linear
elastisch analysiert worden, d. h., es wurde als Berechnungsgrundlage eine lineare Verlänge-
rung des elastischen Bereichs des Spannungs-Dehnungsdiagramms verwendet. Die Problem-
stellung wird nun dahingehend erweitert, dass ein Material gewählt werden soll, das einem
realistischen, nichtlinearen Verlauf des Spannungs-Dehnungs-Diagramms gehorcht. Bei dem
in diesem Beispiel betrachteten Bauteil handelt es sich um einen Handgriff für einen Flug-
gastsitz. Dieser Griff wird einseitig belastet und besteht aus einer MgAl-Gusslegierung und
wird im Druckgussverfahren gefertigt. Das Material hat eine Fließgrenze bzw. 0,2-%-Dehn-
grenze von
105R
2,0p
N/
2
m
m
. Die Fließgrenze liegt also deutlich unterhalb der Zug-
festigkeit von
180R
m
N/
2
m
m
, sodass ausgeprägtes Fließen des Materials anzunehmen
ist. Um Fließen aber programmtechnisch erfassen zu können, muss ein eindeutiger Zu-
sammenhang gegeben sein zwischen den von den Spannungen hervorgerufenen Dehnungen.
Zur Beschreibung dieses Zusammenhanges wählen wir das so genannte Ziegler-Prager-
Gesetz.
Die Strukturmechaniker Prager und Ziegler entwickelten in den 50er-Jahren Gesetzmäßig-
keiten, mit denen der Vorgang der Verfestigung bei plastischen Umformvorgängen mathe-
matisch beschrieben werden kann, siehe auch Bild 10.1. Mithilfe dieses Gesetzes wird aus
der Fließgrenze, der Bruchfestigkeit und der maximalen Bruchdehnung von 5 % ein
Materialverhalten, ähnlich dem im Bild 10.1 unter e gezeigten, generiert.
V
(N/mm )
2
0,2
5,0
H
(%)
2
1
3
plastischer
Bereich
elastischer
Bereich
Bild 10.1:
Spannungs-Dehnungsgesetz:
c ideal-plastisches Verhal-
ten
d Verhalten nach Prager
e Verbesserung des
Prager-Gesetzes nach
Ziegler
