Will D., Gebhardt N. (Hrsg.) Hydraulik: Grundlagen, Komponenten, Schaltungen
Подождите немного. Документ загружается.

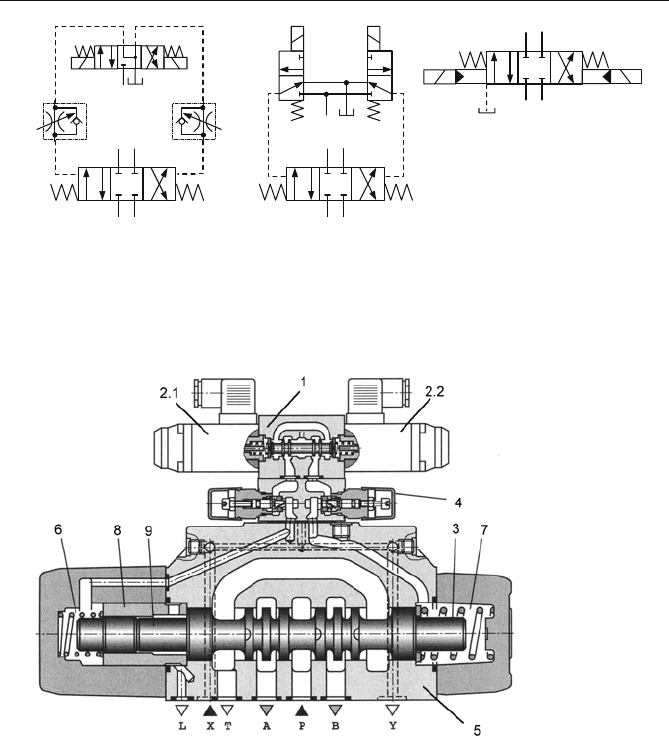
258 8 Ventile
102
PT
A
B
c
102
P
T
AB
T
X
P
X
120
a
102
P
T
AB
1
0
1
0
P
X
T
X
b
Abb. 8.49 Elektrohydraulische Vorsteuerung für Wegeventile. a 4/3-Wegeventil mit 4/3-
Vorsteuerventil und Drosselrückschlagventilen zur Beeinflussung der Schaltgeschwindig-
keit b 4/3-Wegeventil mit zwei 3/2-Vorsteuerventilen c vereinfachtes Symbol für die Schal-
tungen nach a und b
Abb. 8.50 Elektrohydraulisch vorgesteuertes Wegeventil, druckzentriert (Mannesmann
Rexroth). 1 Vorsteuerventil, 2.1 und 2.2 Magnete, 3 und 9 Steuerkolben mit unterschiedlich
wirkenden Flächen, 4 Zwillings-Doppelrückschlagventil, 5 Hauptventil, 6 und 7 Steuer-
räume, 8 Zentrierbuchse
8.4.2 Drehschieberventile
Drehschieberventile werden in der Praxis oft für spezielle Anwendungen ein-
gesetzt. Eine der bekanntesten Varianten ist in der Fahrzeugtechnik das Lenkventil
für hydraulisch unterstütze Servolenkungen. Es zeichnet sich durch einen relativ
einfachen Aufbau aus. Grundlegend kann man von einem 4/3-Wege-Stetigventil
sprechen (Schaltsymbol in Abb. 8.51 a). Die für die Funktion wesentlichen Bau-
teile sind in Abb. 8.51 b dargestellt.

8.4 Wegeventile 259
a b
Abb. 8.51 Drehschieberventil. a Schaltzeichen b Bauteile [8.46] 1 Drehstab, 2 Steuer-
buchse, 3 Drehschieber
Die Anschlüsse zum Lenkzylinder (A, B) dürfen aber nur gegeneinander ge-
schlossen werden, wenn ein Moment am Lenkrad wirkt. Dazu muss z. B. das Ge-
häuse des Ventils (Steuerbuchse) dem Ventilschieber (Drehschieber) nachgeführt
werden, so dass bei Beendigung des Lenkvorgangs die hydraulische Unterstützung
abgeschaltet ist und sich die hydraulische Mitte wieder einstellt. In dieser Neutral-
stellung sind die Zylinderanschlüsse nun wieder miteinander verbunden. Dadurch
sind äußere Kräfte, die am Rad wirken, am Lenkrad spürbar (Reaction-Lenkung).
Auch eine Selbstrückstellung des Lenkrades ist gewährleistet. Diese Mitten-
zentrierung übernimmt der Drehstab, der auf der Lenksäulenseite mit dem Dreh-
schieber und auf der Ritzelseite mit der Steuerbuchse mechanisch verbunden ist.
Erfolgt keine Lenkbewegung, sind alle Steuerkanten geöffnet, d. h. das von der
Pumpe geförderte Öl wird durch das Lenkventil zum Ölbehälter zurückgefördert.
Um die Zahnstange gegen die wirkenden Spurstangenkräfte zu verschieben,
muss der Fahrer während der Drehbewegung des Lenkrades ein Moment auf-
bringen. Hierbei werden Drehschieber und Steuerbuchse gegeneinander verdreht
(Abb. 8.52). Zum Einfahren des in Abb. 8.52 dargestellten Lenkzylinders, gelangt
das von der Hydraulikpumpe geförderte Öl über die Zulauf-Radialnut 1 und die
drei geöffneten Zulauf-Steuerkanten 2 in die drei zugehörigen Ablauf-Axialnuten
3 und weiter über die Ablauf-Radialnut 4 zum Lenkzylinderanschluss A. Nun baut
sich ein Druck in der entsprechenden Zylinderkammer auf und unterstützt die me-
chanisch eingeleitete Zahnstangenbewegung. Das in der anderen Zylinderkammer
verdrängte Öl gelangt zum Anschluss B des Lenkventils und weiter über eine
Rücklauf-Radialnut 5 und die drei Rücklauf-Steuerkanten 6 des Drehschiebers
zum Anschluss T und folgend zum Ölbehälter zurück. Analog verhält sich dieser
Ölfluss bei entgegengesetztem Lenken. Zusammenfassend kann man feststellen,
dass, solange sich der Torsionsstab verdreht, eine Nachführung der Steuerbuchse
und demzufolge eine hydraulische Unterstützung erfolgt.
Die Ventilkennlinien, folglich auch das Lenkverhalten des Fahrzeuges, können
durch die Steuerkantengeometrie, die Öffnungsquerschnitte und die Drehstab-
steifigkeit beeinflusst werden. Die Form der Steuerkanten wirkt sich auf die Lenk-
kräfte und das Lenkgefühl während des Fahrbetriebes aus. Vor allem im Über-
gangs- oder Anlenkbereich (geringfügiges Öffnen der Steuerkanten) können durch
eine spezielle Kantengestaltung Rattergeräusche vermieden werden. Über die
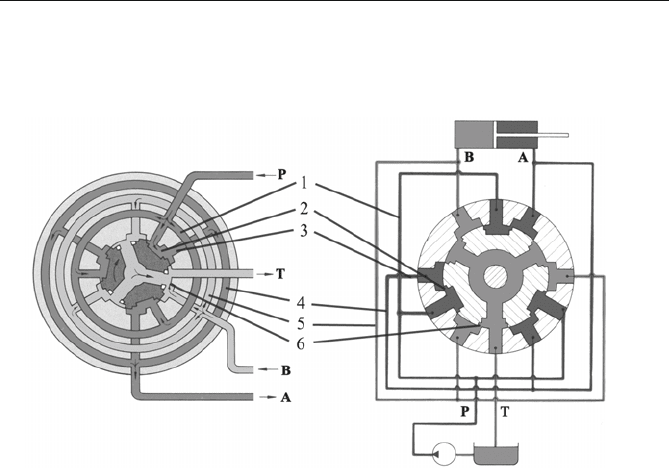
260 8 Ventile
Drehstabsteifigkeit, also maßgebend über den Drehstabdurchmesser bzw. Mitten-
versteifungen, wird bestimmt, wie groß das Lenkmoment sein muss, bis überhaupt
die hydraulische Unterstützung im besagten Anlenkbereich einsetzt.
Abb. 8.52 Funktionsschema des Drehschieberventils [8.46]
8.4.3 Zwei-Wege-Einbauventile als gesteuerte Einzelwiderstände
2-Wege-Einbauventile sind gesteuerte Einzelwiderstände. In ihrer Grundvariante
sind es Sitzventile. Für bestimmte Funktionen werden auch Schieberventile ver-
wendet. Im einfachsten Fall verwirklichen sie die Schaltstellungen „gesperrt“ und
„geöffnet“ für die beiden Hauptanschlüsse A und B. In den siebziger Jahren wur-
den diese Ventile auch als Logikventile bezeichnet.
Die Entwicklung und der Einsatz der 2-Wege-Einbauventile erfolgte auf Grund
der Forderung zur besseren Beherrschung großer Volumenströme bei geringem
Einbauvolumen. Die Anwendung der 2-Wege-Einbauventile konzentrierte sich
zunächst auf große Hydraulikpressen und den Schwermaschinenbau. Sie ist aber
inzwischen auch bei großen Maschinen im mobilen Sektor anzutreffen. Durch die
Auflösung der Steuerfunktionen herkömmlicher Ventile in Einzelfunktionen und
die verschiedenen Ansteuermöglichkeiten bis zur Mehrfachansteuerung lassen
sich mit der gleichen Grundausführung Wege-, Druck-, Strom- und Sperrventile
aufbauen.
Die Normung der 2-Wege-Einbauventile nach DIN 24342 umfasst die Nenn-
größen 16 bis 100 und konzentriert sich auf die Hauptmaße der Blockeinbaustu-
fenbohrung mit den Hauptanschlüssen A und B, der Deckelauflagefläche mit den
Befestigungsschrauben sowie der Lage der Steueranschlüsse X und Y.
Ein 2-Wege-Einbauventil besteht i. d. R aus dem Steuerblock mit Stufen-
bohrung (Abb. 8.53), einem Einbausitzventil (Abb. 8.42 a oder b) oder einem Ein-
bauschieberventil (Abb. 8.53 c oder d), einem Deckel und einem Ansteuerventil.
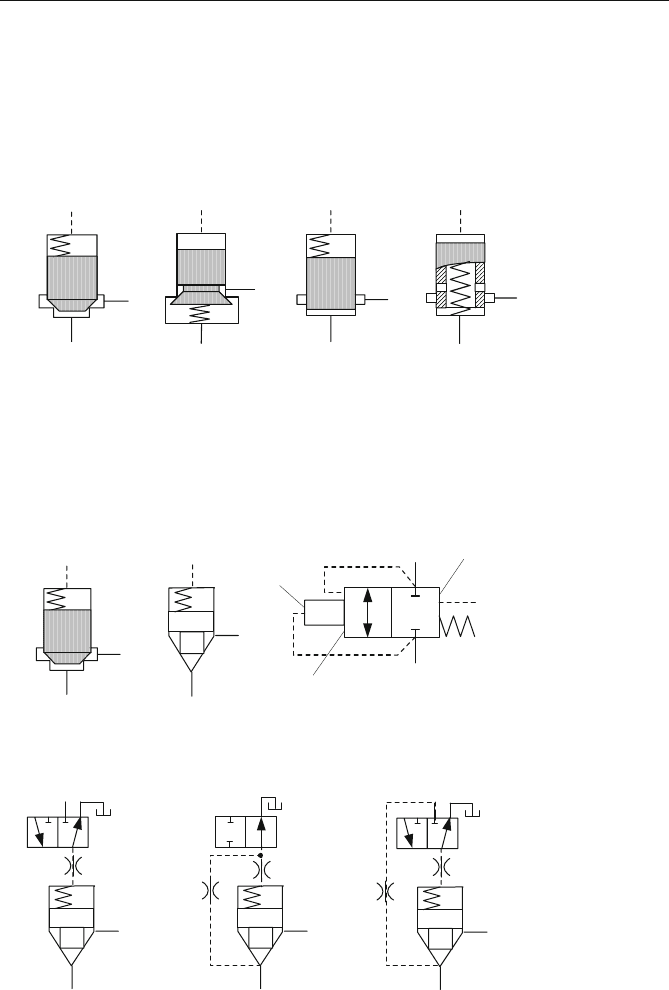
8.4 Wegeventile 261
Mit den Einbausitzventilen ist Dichtheit zu gewährleisten. Dabei muss beachtet
werden, dass die Dichtheit nur dann gesichert ist, wenn als Ansteuerventil auch
ein Sitzventil zur Anwendung kommt [8.33]. Die Einbausitzventile sind mit ver-
schiedenen Flächenverhältnissen belegt. In der Praxis sind Flächenverhältnisse
A
X
/A
A
= 1 bis 2 für die unterschiedlichsten Ventilfunktionen im Einsatz. (Flächen-
bezeichnungen nach Abb. 8.53 c).
A
B
X
X
B
A
X
B
A
A
B
X
a
b
c
d
Abb. 8.53 Schematische Darstellung von 2-Wege-Einbauventilen. a und b Sitzventile c und
d Schieberventile
Einbausitz- und Einbauschieberventile können als Öffner oder als Schließer,
vom Steuerdruck p
X
aus gesehen, ausgeführt werden. (s. Abb. 8.53). Die mögliche
Symbolik der 2-Wege-Einbauventile ist in Abb. 8.54 dargestellt.
B
A
X
A
A
A
B
A
X
B
A
X
A
B
X
a
b
c
Abb. 8.54 Symboldarstellung des 2-Wege-Einbauventils. a Schematische Darstellung b
Symbol nach DIN 24342 c Symbol nach DIN ISO 1219-1
B
A
X
p
0
B
A
X
B
A
X
a
b
c
Abb. 8.55 2-Wege-Einbauventile mit verschiedenen Vorsteuerventilen. a mit Fremdsteuer-
druck p
0
und 3/2-Vorsteuerventil b mit Eigendruck p
A
und 2/2-Vorsteuerventil c mit Eigen-
druck p
A
und 3/2-Vorsteuerventil
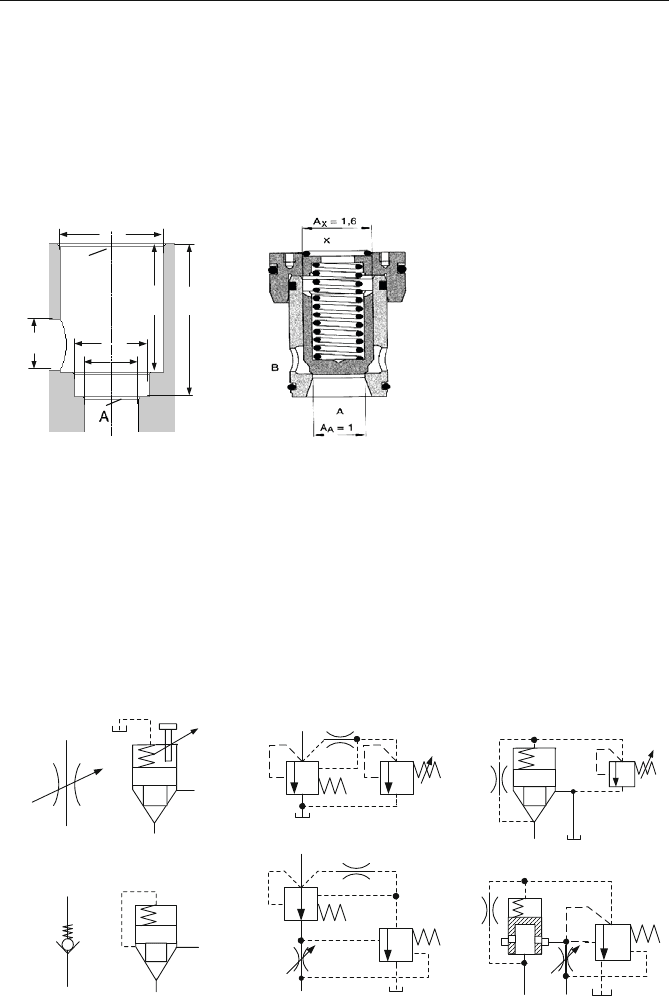
262 8 Ventile
Die Ansteuerung des Einzelwiderstandes (Abb. 8.55) lässt sich z. B. mit
Fremdsteuerdruck (a), mit Eigendruck p
A
(b oder c) bzw. mit Eigendruck p
B
ver-
wirklichen. Mit den Drosseln in den Steuerleitungen lassen sich die Schaltzeiten
zum Öffnen bzw. Schließen beeinflussen.
Mit 2-Wege-Einbauventilen (s. Abb. 8.56) können komplexe Ventile, z. B. die
herkömmlichen Wegeventile und andere Ventilfunktionen und Ventil-
kombinationen aufgebaut werden (vgl. Abb. 8.57 bis Abb. 8.59).
a
B
d
2
d
3
d
4
t
1
t
2
d
1
X
b
Abb. 8.56 2-Wege-Einbauventil (Bosch). a Einbauraum nach DIN 24342 b Einbau-Sitz
-
ventil A
A
/A
X
= 1 / 1,6
Der Einsatz der 2-Wege-Einbauventile erfolgt neben der konventionellen Ven-
tiltechnik auf Kolbenschieberbasis und wird im konkreten Anwendungsfall von
den technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten bestimmt. Die besonderen
Vorteile der 2-Wege-Einbauventile werden geprägt durch große Leistungsdichte,
gutes Geräuschverhalten, geringe Druckspitzen, hohe Schaltgeschwindigkeiten
und Flexibilität. Nachteilig ist der hohe Aufwand bei der Blockkonstruktion, der
Fehlersuche und bei der Änderung der Steuerung zu verzeichnen [8.34 8.37].
B
A
b
A
B
e
B
A
f
P
T
c
p
0
A
B
g
PT
d
p
0
AB
h
a
A
B
Abb. 8.57 Ventilfunktionen, aufgebaut aus 2-Wege-Einbauventilen. a und b Drosselventil
c und d vorgesteuertes Druckbegrenzungsventil e und f Rückschlagventil, g und h vor-
gesteuertes Zwei-Wege-Stromregelventil
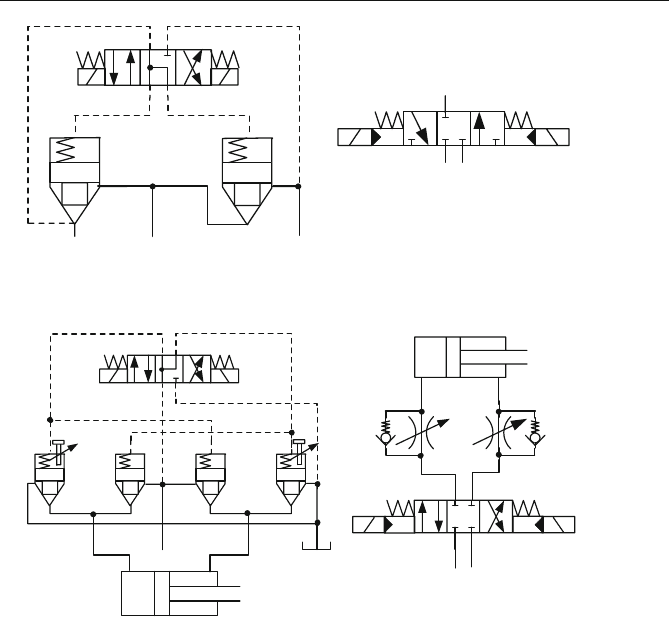
8.5 Elektrisch betätigte Stetigventile 263
PA T
102
a
A
1 02
T
P
b
Abb. 8.58 Vorgesteuertes 3/3-Wegeventil. a Symbol b vereinfachtes Symbol
a
102
PTBA
102
PT
AB
b
Abb. 8.59 Vorgesteuertes 4/3-Wegeventil. a Symbol b vereinfachtes Symbol (innerhalb ei-
nes Antriebes)
8.5 Elektrisch betätigte Stetigventile
Mit Hilfe elektrisch betätigter Stetigventile in Verbindung mit einer auf sie zu-
geschnittenen Ansteuerelektronik können die Bewegungen und die
Kräfte/Momente hydraulischer Antriebe stetig gesteuert werden. Diese Ventile
sind oft typische sog.
mechatronische Komponenten, wenn zumindest Mechanik
und Elektronik, hier zusätzlich Fluidtechnik und Sensorik und oft auch noch
Informatik in Form von digitalen Regelungen, komplex zusammenwirken.
Sehr hohe technische Forderungen erfüllt das Servoventil, vielfach exakter mit
Servowegeventil bezeichnet. Es ist sehr teuer in der Herstellung und stellt an Ein-
satzumgebung und Pflege hohe Ansprüche.
Das Ersetzen der Schaltmagnete in Wegeventilen durch solche, die ihre Lage
proportional mit einer stetig steuerbaren Eingangsspannung (oder einem stetig
steuerbaren Eingangsstrom) ändern können (Proportionalmagnete), war die Basis
für die Entwicklung einer weiteren Linie von Stetigventilen, die Proportional-

264 8 Ventile
ventiltechnik. Sie umfasst den Bereich der Proportional-Wege-, -Druck- und
(seltener) Proportional-Stromventile. Diese Stetigventile sind vor allem in der
Automatisierungstechnik weit verbreitet, da sie eine robuste und relativ preis-
günstige Schnittstelle der Hydraulikantriebe zum elektrischen Signalkreis in
diesen Anlagen sind.
Zudem schaffen beide Stetigventilarten Voraussetzungen, in die Bussysteme
unterschiedlichster Prozesse integriert zu werden, z. B. in den CAN-Bus (ver-
breitet vor allem im Mobilbereich), den InterBus-S oder den Profibus [8.38, 8.39].
8.5.1 Servoventile
Die Vorsilbe „Servo“ für diese Ventile drückt aus, dass sie mit kleinsten Ein-
gangsleistungen große Ausgangsleistungen zu steuern in der Lage sind. Sie wur-
den für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt entwickelt und dort vor allem
in lagegeregelten Präzisionsantrieben eingesetzt. Diese Antriebe müssen in der
Lage sein, ständig wechselnde Positionen gegen unterschiedlichste Kräfte bei gro-
ßen zu bewegenden Massen in kürzester Zeit anzufahren. Das erfordert zum einen
eine hochgenaue und damit teuere Fertigung aller Elemente dieser Ventile und
zum anderen Einsatzbedingungen für diese Ventile; vor allem hinsichtlich der Fil-
terung des Fluides, die weitere Kosten verursachen.
In der Automatisierungstechnik sind die Anforderungen oft nicht so hoch, aber
in Kraft- und Lageregelungen, seltener in Geschwindigkeits- oder Drehzahl-
regelungen, kommen Ventile dieser Bauart (oft „entfeinert“ [8.39 – 8.41]) zum
Einsatz.
Servoventile besitzen meist zwei oder (für sehr große zu steuernde Volumen-
ströme) drei hydraulische Verstärkerstufen. Einstufige Servoventile werden selten
eingesetzt, da ihre Leistungsverstärkung begrenzt ist.
Die Ansteuerelektronik stellt einen Strom (seltener eine Spannung) bereit, der
von einem Magnetsystem in eine Beeinflussung hydraulischer Widerstände der
ersten hydraulischen Verstärkerstufe umgewandelt wird. Die Ansteuerelektronik
kann in das Servoventil integriert oder in einem separaten Gefäß untergebracht
sein.
8.5.1.1 Zweistufige Servoventile
In Abb. 8.60 ist der schematische Aufbau eines zweistufigen Servoventils mit Fe-
derrückstellung dargestellt. Das voraussetzungsgemäß leistungsschwache elektri-
sche Eingangssignal verstimmt mit Hilfe eines Magnetsystems eine hydraulische
Brücke (1. Verstärkerstufe oder Vorsteuerstufe) derart, dass der als Verbraucher
fungierende Kolbenschieber verschoben wird und seine meist 4 Steuerspalte ent-
sprechend verändert (2. Verstärkerstufe, Leistungsstufe).
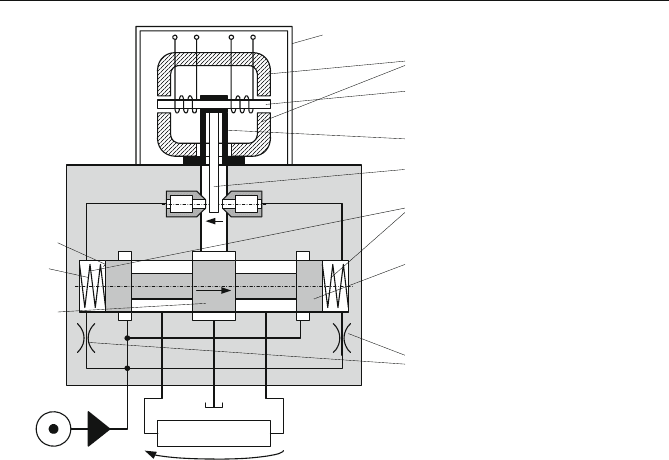
8.5 Elektrisch betätigte Stetigventile 265
PTAB
Steuermotor (Torquemotor)
Biegerohr
Doppeldüse-Prallplatte
Kolbenschieber
Konstantdrosseln (bilden
Brücke mit Doppeldüse-
Prallplatte)
Rückstellfedern
A
S
c
Permanentmagnete
Weicheisenkern
mit Spulen
s
PP
s
Verbraucher
'
p
m
S
Abb. 8.60 Aufbau eines zweistufigen elektrohydraulischen Servoventils mit Federrück-
stellung. P Anschluss an die Druckquelle, T Tankanschluss, A, B Verbraucheranschlüsse
Elektromechanische Eingangsstufe und Vorsteuerstufe. Im Steuermotor (Torque-
motor) befindet sich ein von zwei Spulen umwickelter Weicheisenkern in einem
von Dauermagneten gebildeten Magnetfeld. Sind die Spulen stromlos, wird er von
einem Biegerohr in waagerechter Position gehalten. Werden die Spulen von einem
Gleichstrom durchflossen, bilden sie ihr eigenes Magnetfeld aus und stören die
von den Dauermagneten erzeugten Magnetfelder; die Spulen sind so gewickelt,
dass beide ein gleichsinniges Biegemoment entwickeln. Dadurch werden die mit
dem Weicheisenkern starr verbundene Prallplatte ausgelenkt und die Brücken-
schaltung aus Konstantdrosseln und Doppeldüse-Prallplatte verstimmt.
Die Funktion
'
p = f(s
PP
) und die Kennlinie der Druckdifferenz
'
p in Ab-
hängigkeit von der Prallplattenauslenkung s
PP
sind in Tabelle 4.3 und in Abb. 4.38
abgeleitet worden. Von Interesse ist vor allem der nahezu lineare Teil der Kenn-
linie –s
0
/2 < s < +s
0
/2. Hier gilt in guter Näherung die in Tabelle 4.3 angegebene
linearisierte Beziehung mit den Kennwerten E
0
und C
0
. Der Kolbenschieber mit
Fläche A, Federkonstante c der beiden Rückstellfedern und Masse m ist der Ver-
braucher dieser Brückenschaltung. Das führt auf dem in Abschn. 4.6.2 be-
schriebenen Weg zu dem Blockschaltbild in Abb. 8.61. Geschwindigkeits-
proportionale Reibkräfte wurden gegenüber der Drosselwirkung vernachlässigt,
ebenso die Verzögerung der Prallplattenbewegung s
PP
gegenüber dem Strom i (es
wurde gesetzt: s
PP
/i = K
TM
). Die Induktivität L und der Widerstand R der Spulen
wurden berücksichtigt. Die Federkonstanten der beiden parallel wirkenden Federn
wurden jeweils gleich groß mit c angenommen, so dass sich die Federkraft mit
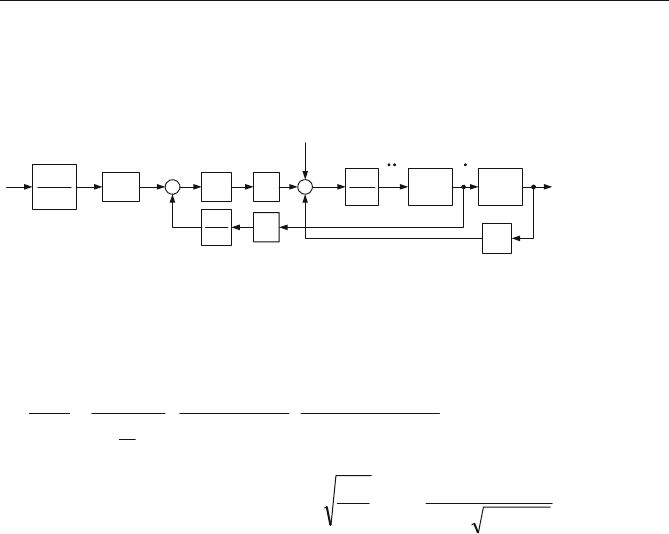
266 8 Ventile
dem Faktor 2 c ändert. In der Störkraft F
Stör
sind alle Einflusskräfte infolge
Federermüdung, Strahlkraft, Schwerkraft, trockener Reibung usw. zusammen-
gefasst.
1
R+L
.
p
u
i
K
TM
s
PP
1
C
0
E
0
-
A
S
A
S
1
m
S
dt
³
dt
³
sss
F
B
2
.
c
F
Stör
-
K
TM
statischer
Übertragungs-
faktor der Po-
sition im Tor-
quemotor
Abb. 8.61 Signalfluss in der elektrischen Eingangs- und in der 1. Verstärkerstufe bei Feder-
rückstellung
Die Übertragungsfunktion s(s)/u(s) ist in Gl. (8.11) angegeben.
22
0
21
1
2
1
/1
)(
)(
sTsDT
c
AEK
ps
R
L
R
pu
ps
STM
mit
c
m
T
S
2
,
S
S
mcC
EA
D
22
0
0
2
.
(8.11)
Die Verzögerung beim Aufbau des Magnetfeldes infolge der Induktivität L der
Spulen wird häufig dadurch kompensiert, dass die Ansteuerelektronik keinen
Spannungs-, sondern einen sog. Stromausgang erhält. (Das ist im regelungs-
technischen Sinne ein Vorhalt.) Dann entfällt der linke Block in Abb. 8.61 und die
Übertragungsfunktion wird entsprechend einfacher.
Die Servoventilvariante in Abb. 8.60 (mit einem Kolbenschieber wie in Abb.
4.36 a) besitzt den Nachteil, dass die Rückstellfedern keine exakte Einhaltung des
Nullpunktes bei s = 0 garantieren (trockene Reibung, Verschmutzung, Material-
ermüdung), weshalb diese Servoventile mit Positionssteuerung des Kolben-
schiebers bei hohen Anforderungen an die Regelgüte des Antriebes nicht zum
Einsatz kommen. Aus dem Signalfluss in Abb. 8.61 ist als bleibender Fehler abzu-
leiten:
'
s/F
Stör
= (2 c)
-1
.
Eine Alternative ist die mechanische Rückführung der Kolbenposition auf die
Prallplatte mit Hilfe einer so genannten Rückführfeder (s. Abb. 8.62 a). Die Rück-
führfeder ist starr mit der Prallplatte verbunden und greift auf der anderen Seite in
eine Nut am Kolbenschieber ein. Führt die Spule des Torquemotors keinen Strom,
zentriert das Biegerohr die Prallplatte und über die Rückführfeder auch den Kol-
benschieber. Lenkt der Torquemotor die Prallplatte nach links aus, wird die Brü-
cke so verstimmt, dass sich der Kolbenschieber nach rechts bewegt. Die Biege-
feder wird verformt und die Prallplatte wird gegen das Moment des Torquemotors
nach rechts verschoben, bis die Druckdifferenz in der Brückendiagonale und da-
mit auch s
PP
null sowie M
TM
= M
RFF
sind. In Abb. 8.62 b sind schematisch Prall-
platte und Rückführfeder dargestellt, um die als Biegefeder ausgebildete Rück-
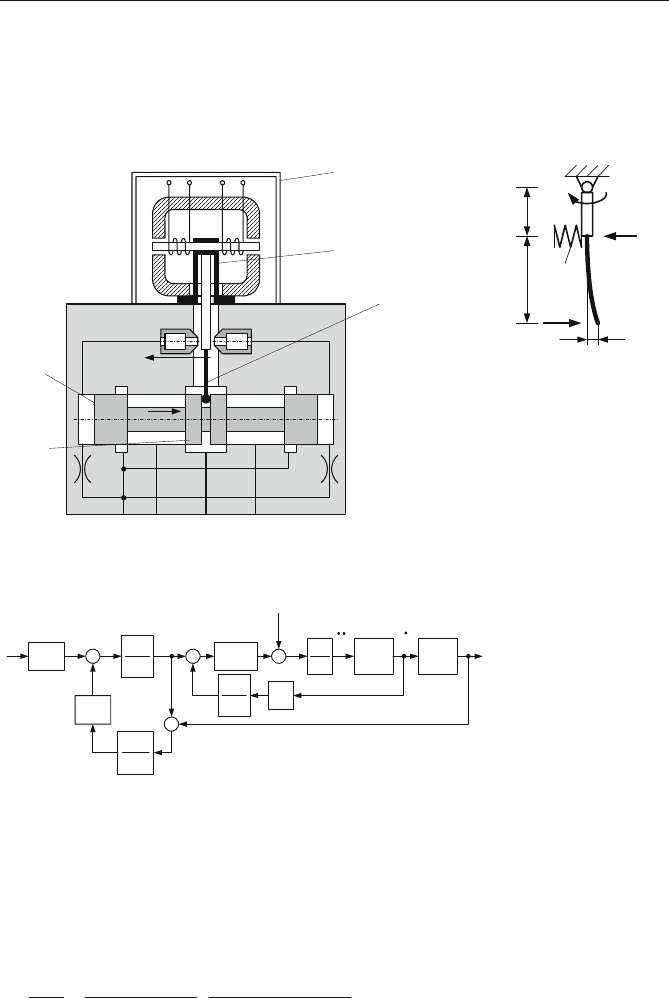
8.5 Elektrisch betätigte Stetigventile 267
führfeder beschreiben zu können und die Hebelverhältnisse zu definieren. Im
Blockschaltbild dieser Vorsteuerstufe (Abb. 8.62 c) ist die allgemeine Biegefeder-
gleichung angewendet worden. Die Federrückwirkung erfolgt über die 1. Ver-
stärkerstufe hinweg, weshalb kleine Störungen in relativ große Gegenreaktionen
umgesetzt werden.
a
PTAB
Rückführfeder
Steuermotor
(Torquemotor)
Biegerohr
s
s
PP
A
S
m
S
f
s
M
TM
l
1
l
2
s
PP
c
b
Torquemotor (TM):
K
TM
*
statischer Über-
tragungsfaktor des
Momentes im Tor-
quemotor
i
K
TM
*
s
PP
1
C
0
E
0
.
A
S
-
A
S
1
m
S
dt
³
dt
³
s
s
s
3E
.
J
l
2
3
M
TM
M
RFF
-
1
l
1
.
c
l
1
+l
2
F
RFF
f
F
Stör
F
B
c
Rückführfeder (RFF):
E Elastizitätsmodul
J Flächenträgheits-
moment
f Biegeweg
F
RFF
, M
RFF
Kraft,
Drehmoment
Biegerohr: c Federkon-
stante, auf Düsenachsen
bezogen
Abb. 8.62 Zweistufiges elektrohydraulisches Servoventil mit mechanischer Rückführung
der Kolbenschieberposition. a Aufbau b Prallplatte mit Rückführfeder c Blockschaltbild
Die zu Gl. (8.11) adäquate Übertragungsfunktion (es wird von einem Strom-
ausgang der Ansteuerelektronik ausgegangen) lautet hier (näherungsweise wird
der Biegeweg f = s gesetzt):
22
21
*
21
1
)()(
)(
sTsDT
llc
K
si
ss
RFF
TM
(8.12)
