Golloch R. Downsizing bei Verbrennungsmotoren: Ein wirkungsvolles Konzept zur Kraftstoffverbrauchssenkung
Подождите немного. Документ загружается.

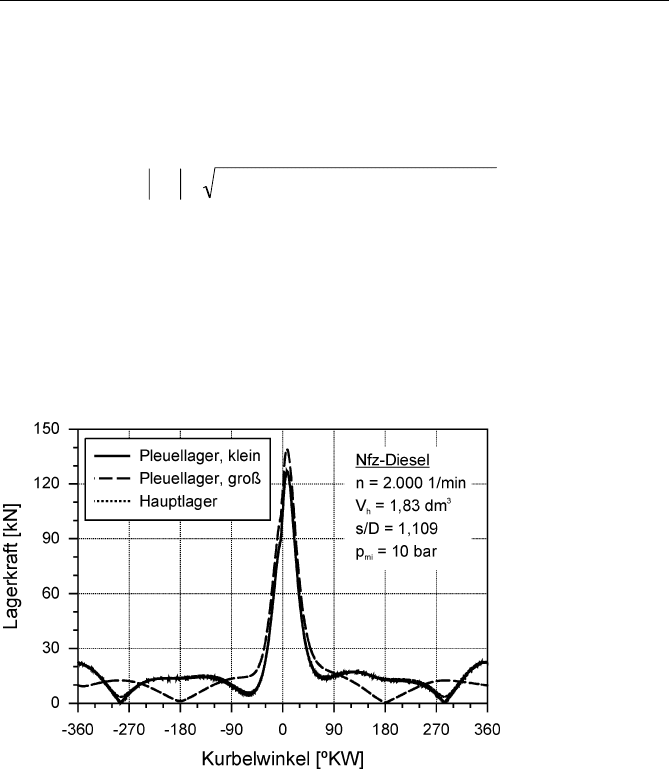
4.4 Motormechanik und Wärmehaushalt 315
F
M,P,rot
und Gegengewicht F
M,GG,rot
zusammen. Mit Definition der gesamten rotie-
renden Massenkraft
rotGGMrotKRMrotPMgesrotM
FFFF
,,,,,,,,
(4.94)
gilt für den Betrag der Hauptlagerkraft
BFFAFFFF
PgesrotMPgesrotMHLHL
|
,,
22
,,
2
&
.
(4.95)
Für die Faktoren
A und B sind wieder die Beziehungen nach Gln. 4.91 und 4.92
zu verwenden. Wird davon ausgegangen, dass die rotierenden Massenkräfte einer
Kurbelkröpfung weitgehend ausgeglichen sind, so wirkt auf das Hauptlager in
erster Linie die Pleuelkraft. Abb. 4.120 zeigt beispielhaft die Verläufe der Lager-
kräfte vom Pleuel und dem Grundlager für einen direkteinspritzenden Dieselmotor
auf Nfz-Basis. Dabei sei erwähnt, dass auch hier die Motorbauart und das Brenn-
verfahren die Lagerbelastung wesentlich bestimmen und die Verläufe unterschied-
lich ausfallen.
Abb. 4.120. Lagerkräfte des Triebwerks als Funktion des Kurbelwinkels
Die Lagerkraft im großen Pleuelauge beinhaltet die rotierende Massenkraft des
Pleuels und hat daher stets einen anderen Verlauf als Grundlagerkraft und Kraft
im kleinen Pleuelauge. Grundsätzlich ändert sich sowohl die Amplitude als auch
die Wirkrichtung der Lagerkräfte über dem Arbeitsspiel. Zur Beschreibung dieser
Belastungsrichtungen haben sich sogenannte Polardiagramme, die entweder zap-
fenfest oder schalenfest definiert werden, als hilfreich erwiesen. Damit ist bei-
spielsweise auf einfache und anschauliche Art zu ermitteln, wo der am geringsten
belastete Bereich des Zapfens ist, sodass dort die Bohrung zur Zuführung des
Schmiermittels eingebracht werden kann.
Die Vorgänge innerhalb des Gleitlagers sind sehr komplex, da eine große An-
zahl von Einflussparametern vorhanden ist. Dies hat dazu geführt, dass die Funk-

316 4 Relevante Subsysteme und Prozesse
tion eines Gleitlagers mit dem hydrodynamischen Druckaufbau lange Zeit nicht
verstanden wurde und nur Erfahrungswerte eine Rolle spielten. Das eigentliche
kraftübertragende Maschinenelement innerhalb des Gleitlagers ist der Schmier-
film. Der tragende Schmierdruck entsteht dabei infolge zweier unterschiedlicher
Prozesse: einerseits durch den konvergenten Spalt, indem der Schmierstoff dank
seiner Adhäsion und Viskosität durch die Gleitbewegung mitgerissen und in den
sich verengenden Spalt gefördert wird, und andererseits durch den zeitlich be-
grenzten Verdrängungseffekt (Squeeze-Effekt) bei radialer Zapfenverlagerung.
Der Druckaufbau durch den konvergenten Spalt erfolgt immer dann, wenn der
Zapfen mit einer ausreichenden wirksamen Winkelgeschwindigkeit dreht. Bei
instationärer Belastung erfolgt der Druckaufbau zusätzlich durch Verdrängung,
wobei der Druck von der Verdrängungsgeschwindigkeit bestimmt wird. Beide
Druckanteile überlagern sich in der Praxis, sodass der Druck innerhalb des
Schmierfilmes mehrere tausend bar erreichen kann.
Da die Lagerdurchmesser direkt den Zapfendurchmesser bestimmen, wirken
sich kompakte Lager aufgrund geringerer Überlappungen von Hubzapfen und
Grundzapfen negativ auf die Kurbelwellensteifigkeit aus und stehen damit dem
Ziel eines günstigen Akustikverhaltens sowie ggf einer ausreichenden Betriebsfes-
tigkeit entgegen [DUE03]. Kleine Lagerspiele führen einerseits zu hoher hydrody-
namischer Tragfähigkeit des Lagers, andererseits jedoch auch zu einer hohen
Reibleistung. Dabei ist zu beachten, dass die Reibleistung stets einem Wärme-
strom entspricht, der vom Lager abgeführt werden muss und entsprechende Öl-
durchsätze erfordert.
Für einen zuverlässigen Betrieb des Lagers ist eine hohe Parallelität von Zap-
fenachse und Lagerschalenachse anzustreben, damit sogenannte Kantenträger, die
nach kurzer Zeit die Laufschicht beschädigen, vermieden werden können. Diese
Forderung kann am ehesten durch eine hohe Steifigkeit von Kurbelwelle und
Kurbelgehäuse bzw. Lagerstuhl erfüllt werden. Leichtmetallkurbelgehäuse und
Kurbelwellen mit großen Hüben haben aufgrund der höheren Elastizität hier prin-
zipiell Nachteile und verbieten zu geringe Lagerspiele, wodurch der Schmieröl-
durchsatz ansteigt.
Wesentlichen Anteil am Tragverhalten eines Gleitlagers hat der eigentliche La-
gerwerkstoff, der heute als Verbundwerkstoff ausgeführt ist. Neben guten Gleitei-
genschaften sollte der Lagerwerkstoff mechanisch hoch belastbar und verschleiß-
beständig sein sowie eine hohe Anpassungsfähigkeit an den Zapfen und ein gutes
Einbettvermögen für Fremdkörper besitzen. Abb. 4.121 gibt einen Überblick über
heutige Gleitlager und die erreichbaren Schmiermitteldrücke. Der entscheidende
Schritt zum hochbelastbaren Lager wurde durch Einführung des Stahl-
Bleibronze(PbSnCu)-Verbundlagers möglich, welches in weiterentwickelter Form
in Kurbeltrieben bis heute eingesetzt wird. Bekannter Vertreter sind das sogenann-
te Zweistofflager oder das Dreistofflager, dessen Grundlage eine Stahlstützschale
als Steifigkeit gebendes Bauteil bildet und einen Bleibronze-Aufguss mit einer
Weißmetall-Laufschicht besitzt. Rillenlager weisen eine spezielle Geometrie der
Oberfläche auf. Hochleistungsmotoren verwenden nahezu ausschließlich Sputter-
lager, deren Laufschicht aus AlSn mittels PVD (Physical Vapor Deposition)-
Verfahren aufgebracht wird und die spezifische Belastungen bis 125 N/mm
2
auf-
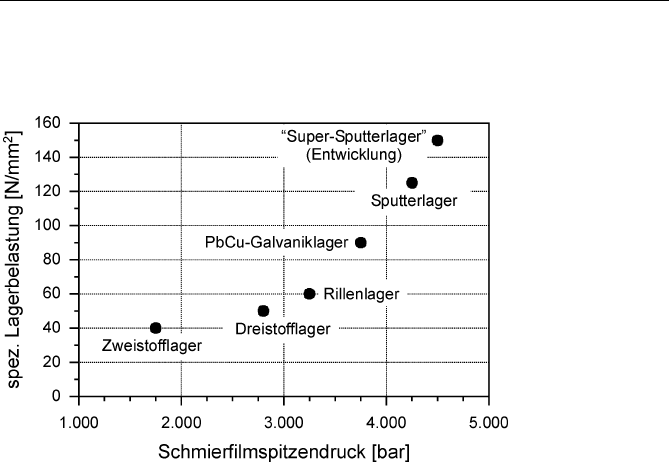
4.4 Motormechanik und Wärmehaushalt 317
nehmen können [GRA03]. Lagerwerkstoffe mit einer Belastung von 150 N/mm
2
,
die ebenfalls das Sputter-Verfahren benötigen, befinden sich derzeit in der Ent-
wicklung.
Abb. 4.121. . Belastungskennwerte heutiger Lagerwerkstoffe
Die Hauptlagerkraft teilt sich auf zwei benachbarte Grundlager auf. Trotzdem
können Pleuellager stärker belastet werden als Grundlager, da sie einer günstige-
ren Belastungsart unterworfen sind. Während der Druckaufbau innerhalb des
Pleuellagers aufgrund häufiger Anlagewechsel vorwiegend durch Verdrängung
erfolgt und diese Belastung nur kurze Zeit andauert, dominiert in den Grundlagern
der Druckaufbau durch konvergenten Spalt, was zu entsprechend geringeren Öl-
filmdicken im Minimalspalt führt [ZIM99]. Bei hoch belasteten Gleitlagern wer-
den durch starke Wechselbeanspruchung ausgeprägte Druckschwankungen inner-
halb des Schmiermittels erzeugt, die zum Phänomen der Kavitation führen kön-
nen. Dabei wird örtlich der Dampfdruck unterschritten, und es bilden sich Dampf-
blasen, die bei Druckanstieg implodieren und erhebliche Druckimpulse auf das
Lagermaterial übertragen. Der Werkstoff kann dabei zerrüttet werde.
4.4.3 Nebenaggregate und Wärmehaushalt
Der Motor hat neben der Bereitstellung mechanischer Leistung an der Kurbelwelle
auch Energie zum Antrieb der Nebenaggregate Ölpumpe, Kühlmittelpumpe, Ge-
nerator, Servopumpe, Kraftstoffpumpe und Klimakompressor zu liefern. Die hier-
für erforderliche Antriebsleistung wird den mechanischen Verlusten zugeordnet
und bestimmt damit den mechanischen Wirkungsgrad des Motors in hohem Maße.
Einige der genannten Nebenaggregate werden durch den Betrieb bei hohen Mit-
teldrücken besonders beeinflusst, sodass eine detailliertere Betrachtung sinnvoll
ist.
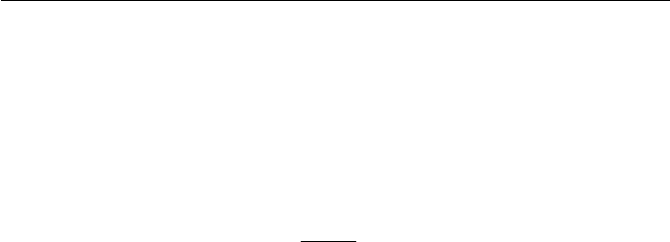
318 4 Relevante Subsysteme und Prozesse
Kraftstoff-Hochdruckerzeugung
Downsizing-Konzepte erfordern die Einbringung vergleichsweise großer Kraft-
stoffmengen in die Brennräume, um die gewünschten Mitteldrücke darstellen zu
können. Sofern für das Brennverfahren hohe Einspritzdrücke generiert werden
müssen, sind damit hohe Antriebsleistungen für die Kraftstoffversorgung verbun-
den, die insbesondere im Teillastbetrieb zu einer Wirkungsgradreduzierung füh-
ren. Die Antriebsleistung der Kraftstoff-Hochdruckpumpe berechnet sich zu
KP
B
KPA
Vp
P
K
'
,
.
(4.96)
Der Kraftstoffdruck ist vom Brennverfahren vorgegeben, damit eine gute Zer-
stäubung und stabile Verbrennung erzielt wird. Um die Antriebsleistung zu mini-
mieren, ist einerseits eine mengenmäßige Bedarfsregelung nötig, bei der von der
Hochdruckpumpe nur soviel Kraftstoff gefördert wird, wie der Motor im jeweili-
gen Betriebspunkt auch benötigt. Andererseits sollte der Wirkungsgrad der Pumpe
möglichst hoch ausfallen.
Dieselmotorische Einspritzsysteme erzeugen Einspritzdrücke bis über 2.000
bar. Bei Volllast trägt die Einspritzpumpe daher erheblich zu den Reibungsverlus-
ten des Dieselmotors bei. Das deutlich niedrigere Druckniveau bei der ottomotori-
schen Kraftstoffeinspritzung führt im Vergleich zum Dieselmotor zu geringeren
Antriebsleistungen der Einspritzpumpen, wobei direkt einspritzende Ottomotoren
höhere Anforderungen stellen als die klassische Saugrohreinspritzung.
Steigende spezifische Leistungen erfordern tendenziell einen Anstieg des Ein-
spritzdruckes, da eine Verlängerung der Spritzdauer oder die Verwendung größe-
rer Spritzlöcher innerhalb der Einspritzdüse aus Emissionsgründen (Ruß, NO
x
)
nicht möglich ist. Konsequentes Downsizing führt daher eher zu einem Anstieg
der Antriebsleistung für die Hochdruckerzeugung und damit zu einer Senkung des
mechanischen Wirkungsgrades. Sofern die Einhaltung der gültigen Emissions-
grenzwerte möglich ist, sollte auf eine weitere Steigerung des Einspritzdruckes
verzichtet werden, wenn die Vorteile durch eine wirkungsgradgünstigere
Verbrennung die Nachteile durch hohe Pumpen-Antriebsleistung nicht kompen-
sieren können. Die Darstellung hoher Einspritzdrücke führt zudem zu einer stei-
genden Beanspruchung der Hochdruckpumpen und beinhaltet damit die Gefahr
geringer Lebensdauer.
Kühl- und Ölkreislauf
Die Energieumsetzung durch Verbrennung bedingt hohe lokale Temperaturen im
Brennraum, die 2.000 °C übersteigen können. Um die Brennraum begrenzenden
Bauteile thermisch nicht zu überlasten, ist eine Kühlung erforderlich. Als Faust-
formel gilt, dass der über die Kühlung abzuführende Wärmestrom in etwa der
effektiven Motorleistung entspricht. Ziel der Kühlanlagenauslegung ist die Bereit-
stellung der geforderten Kühlleistung mit kompakten, leichten und kostengünsti-
gen Kühlern. Zur Senkung der Antriebsleistungen für die Kühlmittelpumpe sollte
die Regelung bedarfsgerecht erfolgen.
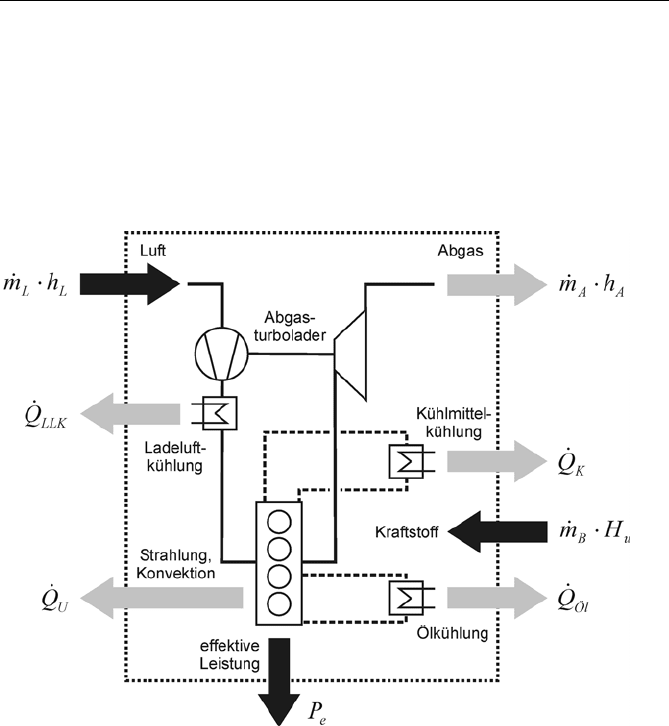
4.4 Motormechanik und Wärmehaushalt 319
Motorische Hochlast-Konzepte bewirken aufgrund der Wirkungsgradsteigerung
eine Senkung der durch das Kühlmittel und das Abgas abzuführenden Wärme-
mengen. Trotzdem fallen bei kompakten Motoren mit hoher Leistungsdichte ent-
sprechende Wärmeströme an, die ein leistungsfähiges Kühlsystem erfordern.
Abb. 4.122 zeigt das vereinfachte Energieflussdiagramm eines Motors mit Abgas-
turboaufladung. Der Übersichtlichkeit halber sind die einzelnen Wärmeströme, bis
auf den Kühlwärmestrom bei AGR-Kühlung, separiert. In der Praxis werden die
Wärmeströme größtenteils über die Kühlmittelkühlung abgeführt.
Abb. 4.122. vereinfachte Darstellung der Energieströme eines turboaufgeladenen Motors
Durch Abgasturboaufladung wird dem Abgas Energie entzogen, sodass sich die
Aufteilung zwischen effektiver Motorleistung, gesamtem Kühlwärmestrom und
Abgaswärmestrom im Vergleich zu Saugmotoren oder mechanisch aufgeladenen
Motoren verändert. Damit vergrößert sich der Anteil des über das Kühlsystem
abzuführenden Wärmestroms, da ein Teil der im Abgasturbolader in Verdichterar-
beit umgesetzten Wärme während der Ladeluftkühlung an das Kühlsystem abge-
führt wird. In der Summe kann der Kühlwärmestrom daher im Falle von Abgas-
turboaufladung sogar zunehmen.
Im Vergleich zu großvolumigen Saugmotoren werden an das Kühlsystem von
hochaufgeladenen Motoren deutlich höhere Anforderungen gestellt. Die Notwen-
digkeit zur Kühlung unterschiedlicher Fluide (Kühlmittel, Öl, Luft, Abgas) stei-
gert die Komplexität des gesamten Kühlsystems beträchtlich. Zum einen erfordert
die hohe Energiedichte eine Wärmeabfuhr vom Kolben über das Schmieröl, so-

320 4 Relevante Subsysteme und Prozesse
dass das Öl zur Vermeidung von Ölalterung separat rückgekühlt werden muss.
Auch die Temperatur der durch Verdichtung erwärmten Ladeluft muss über einen
Ladeluftkühler zur Leistungssteigerung und Emissionssenkung sowie zur Redu-
zierung der Klopfempfindlichkeit abgesenkt werden. Die Forderung nach niedri-
gen Lufttemperaturen macht ggf. einen eigenen Niedertemperaturkreislauf für die
Ladeluftkühlung erforderlich. Im Regelfall wird die verdichtete Luft im LLK mit
der durch den Kühler strömenden Außenluft gekühlt. Eine Wasser-Luft-Kühlung
führt dagegen zu geringem Platzbedarf, geringem luftseitigem Druckabfall sowie
zu einem besseren Ansprechverhalten, siehe Abschn. 4.1, sodass diesen Systemen
trotz höherer Kosten für Downsizing-Konzepte der Vorzug gegeben werden sollte.
Bei hohen Abgasrückführraten ist ebenfalls eine Kühlung des der Luft zugeführten
Abgases sinnvoll. Der Rest der vom Motor an das Kühlwasser abgegebenen Wär-
me – hierunter befindet sich auch ein Teil der durch Reibung entstandenen Wärme
– wird über das Kühlmittel an die Umgebung abgeführt.
Motorische Hochlastkonzepten stellen auch an das Schmiersystem höhere An-
forderungen, allerdings in deutlich geringerem Maße als dies beim Kühlsystem
der Fall ist. Da das Motoröl neben der Schmierung relativ zueinander bewegter
Bauteile auch Kühlfunktionen übernehmen muss, steigen der Öldurchsatz und die
Druckverluste im Ölkreislauf generell an. In der Summe führt das zu einer Zu-
nahme des Leistungsbedarfs für die Ölpumpe. Dieser Sachverhalt muss bei der
Dimensionierung der Ölpumpe berücksichtigt werden und beeinflusst letztendlich
den mechanischen Wirkungsgrad.
Massenausgleich
Ein Teil der durch das Downsizing bzw. durch Reduzierung der Zylinderzahl
erzielten Verbesserungen im mechanischen Wirkungsgrad wird wieder aufgezehrt,
sofern erhöhte Ansprüche an das Schwingungs- und Geräuschverhalten gestellt
werden. Speziell für Fahrzeugmotoren ist es notwendig, geeignete Maßnahmen
zum Ausgleich der den Komfort beeinträchtigenden Massenwirkungen einzulei-
ten. Beispielsweise können die bei 4-Zylinder-Reihenmotoren charakteristischen
oszillierenden Massenkräfte 2. Ordnung durch zwei zusätzliche und gegenläufig
rotierende Wellen mit rotierenden Massen reduziert werden. Der für diesen soge-
nannten Lancaster-Ausgleich erforderliche Aufwand schlägt sich zum einen in den
Kosten und zum anderen in einem leichten Anstieg der Reibungsverluste nieder.
Abb. 4.123 zeigt den Schlepp-Reibmitteldruck für einen Ottomotor mit Saug-
rohreinspritzung, der über einen Lancaster-Ausgleich verfügt. Je nach Drehzahl
beträgt der Leistungsbedarf bis zu 3 kW, was einem zusätzlichen Reibmitteldruck
bis etwa 0,3 bar entspricht und damit den mechanischen Wirkungsgrades negativ
beeinflusst. Bei 3-Zylinder-Reihenmotoren, die als Downsizing-Konzepte eben-
falls zum Einsatz kommen, sollten die Massenmomente 1. und 2. Ordnung redu-
ziert werden. In der Praxis erfolgt dies durch eine separate Welle mit Zusatzmas-
sen, die ein entsprechendes Gegenmoment erzeugt. Aufgrund der höheren Zylin-
derdrücke und größerer Bauteilmassen weisen Dieselmotoren im Allgemeinen
eine höhere Drehungleichförmigkeit auf als Ottomotoren, sodass für den Selbst-
zünder besonders bei geringen Zylinderzahlen Massenausgleichsgetriebe sinnvoll
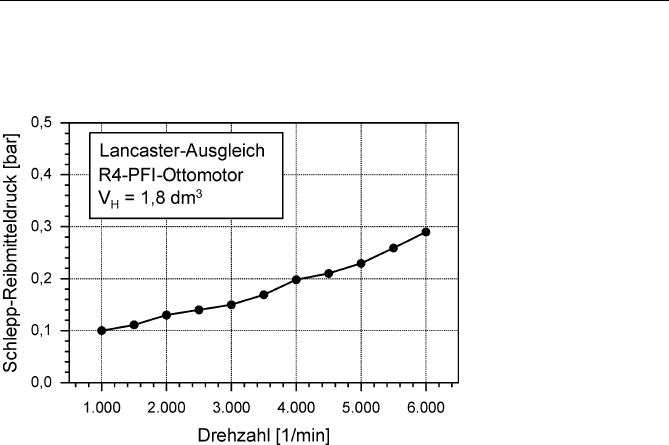
4.4 Motormechanik und Wärmehaushalt 321
sind. Größere Schwungmassen können hier zwar Abhilfe schaffen, jedoch ver-
schlechtert sich das transiente Betriebsverhalten des Motors, bedingt durch das
höhere polare Massenträgheitsmoment.
Abb. 4.123. Schlepp-Reibmitteldruck eines Lancaster-Massenausgleichgetriebes
5 Zusammenfassung und Ausblick
Downsizing in Verbindung mit Aufladung ist ein wirkungsvolles Konzept zur
Kraftstoffverbrauchssenkung bei Verbrennungsmotoren und kann daher wesent-
lich zum Erreichen der Ziele zur CO
2
-Reduktion beitragen. Entsprechende Motor-
konzepte zeichnen sich durch eine hohe Leistungsdichte und hohe maximale Mit-
teldrücke aus, sodass auf ansprechende Fahrleistungen nicht verzichtet werden
muss. Derzeit liegen die Grenzen von Leistungsdichte und effektiven Mitteldruck
bei serienmäßigen Pkw-Dieselmotoren bei 67 kW/dm
3
bzw. 24 bar. Ottomotoren
erreichen 105 kW/dm
3
und ebenfalls 24 bar.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde das Downsizing bei Verbren-
nungsmotoren, die Wirkungsmechanismen sowie die zur Umsetzung eines motori-
schen Hochlastkonzeptes erforderlichen Maßnahmen detailliert und umfassend
beschrieben. Wesentlicher Bestandteil war – ausgehend vom derzeitigen Stand der
Technik der relevanten Subsysteme und Prozesse – die Beschreibung auf den
Betrieb bei hohen Mitteldrücken abgestimmter Lösungsansätze zur Entschärfung
der bei bisherigen Hochlast-Konzepten bestehenden Problembereiche. Es ist damit
gelungen, das zukunftsträchtige Themengebiet Downsizing in der erforderlichen
Breite sowohl für Otto- als auch für Dieselmotoren darzustellen. Die wesentlichen
Erkenntnisse werden im Folgenden zusammengefasst.
Die Verbrauchssenkung durch Downsizing resultiert weniger aus einer generel-
len Wirkungsgradsteigerung als vielmehr aus einer Betriebspunktverlagerung in
Richtung höherer Lasten und damit in Bereiche geringeren, spezifischen Kraft-
stoffverbrauchs. Konsequentes Downsizing mit dem Ziel einer deutlichen
Verbrauchssenkung erfordert eine Reduzierung der Zylinderzahl bzw. vergleichs-
weise große Zylinderhubvolumina. Durch die formbare Drehmomentcharakteristik
aufgeladener Motoren besteht die Möglichkeit einer Absenkung der Nenndreh-
zahl, sodass sich ein weiterer Verbrauchsvorteil aus einer größeren Übersetzung
ergibt. Darüber hinaus kann die Fahrdynamik durch die geringere Aggregatmasse
verbessert und die Leistungsspreizung innerhalb einer Motorenbaureihe bei glei-
cher Zylinderzahl deutlich erhöht werden.
Neben den zahlreichen Vorteilen existieren jedoch auch einige zum Teil gravie-
rende Problembereiche bzw. Risiken, welche die Motorenentwicklung vor große
Herausforderungen stellt. Aufgrund der hohen Leistungsdichte müssen entspre-
chend große Massen an Luft und Kraftstoff in den Brennraum eingebracht werden.
Bei der konventionellen Turboaufladung führt das unzureichende Abgasenthalpie-
angebot bei niedrigen Motordrehzahlen zu einem unbefriedigenden Anfahr- und
Ansprechverhalten. Ein erfolgreiches Hochlast-Downsizing-Konzept erfordert
daher eine Anpassung bzw. Weiterentwicklung der Systeme zur Gemischaufberei-

324 5 Zusammenfassung und Ausblick
tung, des Aufladesystems sowie der Motormechanik und Tribologie mit z.T. neu-
artigen Lösungsansätzen. Diese steigern die Komplexität und Kosten des gesam-
ten Antriebssystems. Unabhängig von den technischen Herausforderungen stellt
die Kundenakzeptanz auf dem Pkw-Sektor ein ganz entscheidendes Kriterium für
den Erfolg von kleinvolumigen und hochaufgeladenen Motoren dar.
Die Ausweitung des Volllast-Mitteldruckes als wesentlicher Bestandteil von
Downsizing-Konzepten wird beim Dieselmotor in erster Linie durch den Zylin-
derspritzendruck bzw. die Motormechanik und Tribologie und beim Ottomotor
durch die Klopfproblematik begrenzt und erfordert entsprechende Maßnahmen.
Beim Ottomotor ist je nach Brennverfahren und Downsizing-Grad und mit Hilfe
von zusätzlichen Maßnahmen die Ausschöpfung eines zyklusrelevanten
Verbrauchspotenzials von 10-30% – ausgehend vom klassischen Saugrohrein-
spritzer ohne Aufladung – möglich. Da beim Dieselmotor die größte Herausforde-
rung in der Erfüllung der zukünftigen Schadstoffgrenzwerte besteht, sind beim
Selbstzünder in den nächsten Jahren nur moderate Verbrauchssenkungen durch
Downsizing zu erwarten.
Mittelfristig wird der klassische Ottomotor mit Kanaleinspritzung als kosten-
günstiger Antrieb Bestand haben. Dynamisches Downsizing durch Zylinderab-
schaltung bietet speziell bei großvolumigen, drosselgesteuerten Ottomotoren, die
häufig im unteren Teillastbereich betrieben werden, beachtliche Verbrauchspoten-
ziale. Dieses Verfahren unterscheidet sich jedoch grundlegend vom „klassischen“,
statischen Downsizing. Die für die Zylinderabschaltung erforderliche Technik
greift in die Ventilsteuerung ein und stellt erhöhte Anforderungen an die Mo-
torsteuerung.
Zur weiteren Steigerung der spezifischen Leistung sowie zur Senkung des
Kraftstoffverbrauchs unter Einhaltung der Schadstoffgrenzwerte ist der Einsatz
von Benzindirekteinspritzung (BDE) unverzichtbares Mittel. Die BDE lässt sich
hervorragend mit der Abgasturboaufladung kombinieren. Als Downsizing-
Konzept bietet die BDE mit Schichtladung nur wenig Vorteile, sodass sich bei den
Hochlast-Konzepten mittelfristig die stöchiometrische Verbrennung durchsetzen
wird. Dieses homogene Brennverfahren nutzt die prinzipbedingten Vorteile der
Direkteinspritzung zu großen Teilen aus und gestattet die Verwendung eines gere-
gelten Drei-Wege-Katalysators zur effizienten und kostengünstigen Abgasnachbe-
handlung. In Verbindung mit der BDE werden teilvariable Ventilsteuerungen auf
der Einlass- und Auslassseite in allen Fahrzeugsegmenten zum Standard avancie-
ren. Damit sind sowohl das Miller-Verfahren als auch die Erzeugung intensiver
Ladungsbewegung zur Steigerung der Restgasverträglichkeit und zur Gemisch-
homogenisierung möglich. Beide Verfahren senken die Klopfneigung, erhöhen
jedoch die Anforderungen an das Aufladesystem.
Insbesondere bei aufgeladenen Ottomotoren, aber auch bei Saugmotoren, die
häufig im Teillastbereich betrieben werden, kann die variable Verdichtung viele
Vorteile bieten. Sofern hier Systeme angeboten werden, die kostengünstig, robust
und mit geringem Energiebedarf für die Verstellung des Verdichtungsverhältnis-
ses dargestellt werden können, ist eine Serieneinführung wahrscheinlich.
Das Kraftstoff-Einspritzsystem muss an die erhöhten Durchsatzspreizungen
zwischen Leerlauf und Nennleistung angepasst werden und erfordert zukünftig

5 Zusammenfassung und Ausblick 325
mehr Variabilitäten sowohl hinsichtlich der Hochdruckerzeugung als auch der
Einspritzrate sowie der Einspritzdüsengeometrien, um neben einer Verbrauchsre-
duzierung auch die gültigen Schadstoffgrenzwerte einhalten zu können.
Hochaufgeladene Motoren benötigen eine leistungsfähige Ladeluftkühlung.
Während beim Ottomotor die Klopfproblematik der wesentliche Antreiber ist, sind
beim Dieselmotor die Stickoxidemissionen besonders zu beachten. Wasser-Luft-
Wärmetauscher bieten hinsichtlich der erreichbaren Kühlleistung sowie des An-
sprechverhaltens Vorteile gegenüber den klassischen Luft-Luft-Wärmetauschern,
sie sind jedoch mit hohen Zusatzkosten verbunden.
Aufgrund der vergleichsweise niedrigen Verdichterwirkungsgrade, des großen
Bauvolumens und der schlechteren Akustik wird die mechanische Aufladung
zugunsten neuer Abgasturboaufladeverfahren an Bedeutung verlieren. Zur Steige-
rung der Leistungsfähigkeit des Aufladesystems speziell im unteren Drehzahlbe-
reich und bei Lastwechseln ist die Kombination von Abgasturboaufladung und
Impulsaufladung viel versprechend, zumal das Impulsaufladesystem mit geringen
elektrischen Leistungen auskommt. Es bleibt abzuwarten, ob die sehr deutliche
Steigerung des Luftaufwandes im unteren Drehzahlbereich auch in ein höheres
Drehmoment umgewandelt werden kann.
Komplexe Aufladesysteme wie die Registeraufladung oder die geregelte zwei-
stufige Aufladung bieten deutliche Vorteile, jedoch sind diese Systeme trotz tech-
nisch einfacher Abgasturbolader mit erheblichen Mehrkosten verbunden, sodass
sich der Einsatz zunächst auf die oberen Fahrzeugsegmente beschränkt. Erst lang-
fristig ist mit einer Top-Down-Strategie zu rechnen, sodass auch die unteren Fahr-
zeugsegmente von dieser Technologie profitieren.
Die elektrisch unterstützte Aufladung in Form von e-Booster oder eu-ATL wird
vermutlich erst dann erfolgreich werden, wenn das Bordnetz auch elektrische
Zusatzleistungen von mehr als 2-3 kW erlaubt. Aus heutiger Sicht ist das praktisch
nur durch Bordnetze mit höherem Spannungsniveau, z.B. 42 Volt, möglich. In
diesem Zusammenhang werden Mild-Hybride langfristig einen festen Anteil an
den Antrieben darstellen, da hiermit zahlreiche Zusatzfunktionen darstellbar sind,
die sich positiv auf Kraftstoffverbrauch und Schadstoffemission auswirken.
Die zur Entschärfung der Problembereiche hochaufgeladener Motoren erforder-
lichen Techniken führen dazu, dass sich Downsizing nicht als kostengünstiges
Maßnahmenpaket darstellen lässt. In den oberen Fahrzeugsegmenten ließen sich
die Mehrkosten zwar eher umsetzen, jedoch besteht hier ein größeres Akzeptanz-
problem (Hubraum, Zylinderzahl) als in den unteren Fahrzeugklassen. Letztere
beeinflussen den Flottenverbrauch aufgrund der hohen Stückzahlen zwar sehr
stark, sind aber sehr kostensensibel.
Mittelfristig werden motorische Hochlastkonzepte fester Bestandteil innerhalb
der angebotenen Fahrzeugpaletten sein. Der Markterfolg wird davon abhängen, ob
es gelingt, ansprechende Fahrleistungen mit niedrigen Kraftstoffverbräuchen zu
kombinieren und dies mit vertretbaren Mehrkosten darzustellen. Der Anteil aufge-
ladener Motoren wird in jedem Fall weiter ansteigen und die Aufladung damit an
Bedeutung gewinnen. Die Zukunft der Verbrennungsmotoren wird daher in ganz
entscheidendem Ausmaß durch Downsizing geprägt.
