Will D., Gebhardt N. (Hrsg.) Hydraulik: Grundlagen, Komponenten, Schaltungen
Подождите немного. Документ загружается.

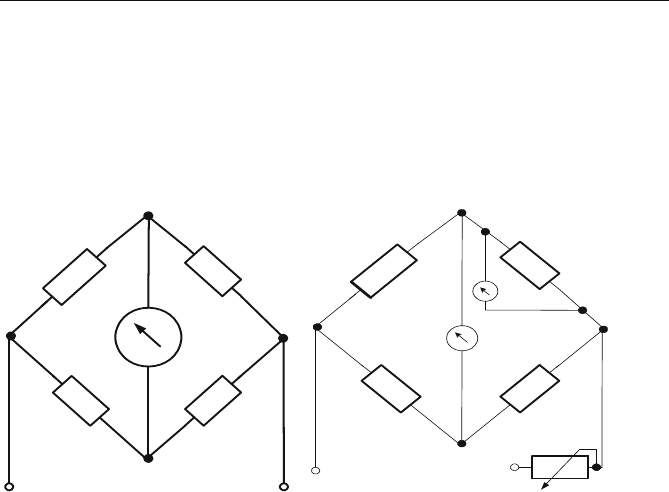
368 12 Messtechnik in der Hydraulik
12.1.5.4 Thermische Verfahren
Diese Verfahren sind dadurch gekennzeichnet, dass eine definierte Wärmemenge
in das Fluid eingeleitet wird und in Strömungsrichtung nach dieser Stelle die
Temperatur gemessen wird. Diese gemessene Temperatur ist maßgeblich vom
Volumenstrom abhängig. Ein Verfahren ist das in Abb. 12.29 dargestellte Hitz-
drahtanemometer mit konstanter Speisespannung.
a
b
Abb. 12.29 Hitzdrahtanemometer. a mit konstanter Speisespannung b mit konstantem
Heizdrahtwiderstand
Bei konstanter elektrischer Heizleistung eines Hitzdrahtes, wird die Temperatur-
absenkung des als Sensor wirkenden Widerstandes
R
H
des Hitzdrahtes gemessen
(
Abkühlverfahren). Die Veränderung von R
H
ergibt sich aus der Tatsache, dass bei
verändertem Volumenstrom eine andere Wärmemenge abgeführt wird. Für das
Verfahren reicht eine geringe Heizleistung aus, allerdings ist es sehr empfindlich
gegen Verschmutzung und elektrischer Überlastung des Messwiderstandes
R
H.
Bei
sehr kleinen Volumenströmen ist bedingt durch die Eigenkonvektion der Mess-
anordnung keine auswertbare Aussage möglich.
Das
Konstanttemperaturverfahren (Abb. 12.29 b) setzt eine regelbare Heiz-
leistung voraus. Der Widerstand des Heizdrahtes
R
H
wird durch Nachregeln der
Heizspannung
U
konstant gehalten. Heizspannung bzw. Heizstrom sind bei ab-
geglichener Brücke ein Maß für den Volumenstrom. Die Empfindlichkeit nimmt
mit zunehmendem Volumenstrom ab. Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Ab-
kühlverfahren ein größerer Messbereich, wobei die Eigenkonvektion bei kleinen
Volumenströmen auch zu beachten ist.
Bei Anwendung des
Aufheizverfahrens wird mittels eines Heizwiderstandes
dem Fluid Wärme zugeführt. Die damit verbundene Erwärmung des Fluids kann
bei konstanter Heizleistung bzw. konstanter Temperaturdifferenz als Maß für den
Volumenstrom genutzt werden. Dem Nachteil einer hohen elektrischen Heiz-
leistung, stehen die Vorteile des linearen Messzusammenhanges und der Un-
abhängigkeit von der Dichte des Fluids gegenüber.
U
R
H
U
R
H
Spannungsmesser
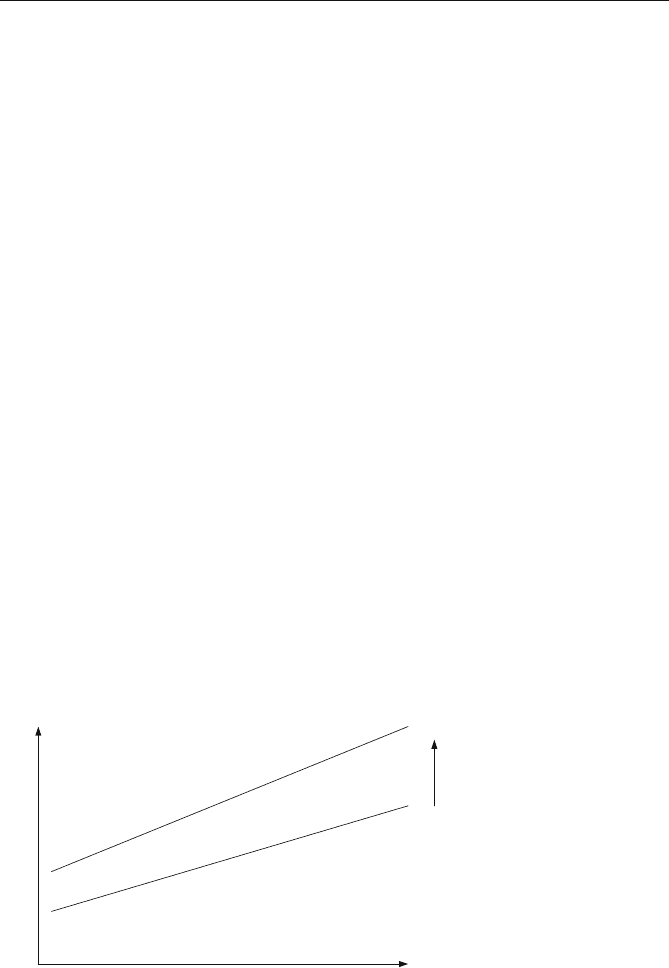
12.1 Messgrößen 369
Im Sinne der Einleitung sind auch thermische Verfahren zu berücksichtigen,
die eine Temperaturdifferenzmessung nutzen um den Wirkungsgrad zu be-
stimmen. Die thermodynamische Wirkungsgradermittlung zeichnet sich im
Gegensatz zur konventionellen Messung des Wirkungsgrades durch einen
geringen gerätetechnischen Aufwand aus. Der Ansatz dieses Verfahrens ist, dass
die gesamte in einer Verdrängereinheit entstehende Verlustleistung in Wärme
umgewandelt wird und nur der Fluidstrom diese Wärme, abgesehen von der Kon-
vektionswärme, abtransportiert. Erfolg versprechende Untersuchungen wurden
von Witt [12.16] nach umfangreichen Untersuchungen der physikalischen und
thermodynamischen Kennwerte von Druckflüssigkeiten (Enthalpie-Entropie-
Diagramm) gemacht. Er entwickelt in eine Rechenflüssigkeit, welche die thermo-
dynamischen Eigenschaften der jeweiligen Druckflüssigkeit erfasst. Mit Hilfe der
Rechenflüssigkeit und den Temperatur- und Druckdifferenzmesswerten kann nun
der Gesamtwirkungsgrad für Pumpen und Motoren mit und ohne äußeren
Leckölvolumenstrom berechnet bzw. aus den erstellten Diagrammen entnommen
werden. Ferner stellt er umfangreiche Betrachtungen zu möglichen Fehlern bei
Nichtbeachtung der Kompressibilität von Hydraulikflüssigkeiten an. Bedingt
durch den weiterhin beträchtlichen experimentellen Aufwand erfolgte keine
praktische Anwendung.
Eine weitere Möglichkeit, ist die Bestimmung des Schädigungszustandes
(s. Kap. 13) auf der Basis einer Temperaturdifferenzmessung [12.41, 12.53]. Der
Schädigungszustand, der eine Kennzahl für den technischen Zustand z. B. der
Hydraulikpumpe darstellt, ermöglicht eine Beurteilung der Lebensdauer. Aus
Abb. 12.30 geht hervor, dass sich die Temperatur mit zunehmenden Verschleiß
unter Berücksichtigung der Messparameter (p, n, T
Öl
) verändert. Die Änderung
des Messwertes Temperatur ist im Vergleich zum von der Hydraulikpumpe ab-
gegebenen Volumenstrom geringer. Dafür ist der Messaufwand sowohl zeitmäßig
als auch kostenmäßig viel geringer. Derzeit laufen zahlreiche Untersuchungen, um
das Verfahren für einen industriemäßigen Einsatz vorzubereiten [12.41, 12.50].
Druck
Tempetraturdifferenz
Schädigung
n=kost,
T=konst
Abb. 12.30 Temperaturdifferenz-Druck-Abhängigkeit für unterschiedlich verschlissene
Zahnradpumpen

370 12 Messtechnik in der Hydraulik
12.1.5.5 Kalibrierung
Die Kalibrierung von Volumenstromsensoren ist eine äußerst aufwendige Aufgabe
[12.40]. In der Regel ist ein Satz von Referenzvolumetern verfügbar, welche alle
drei Jahre mit einem nationalen Normal bei identischen Bedingungen (Durchfluss,
Druck, Temperatur, Prüfmedium) verglichen werden. Die Referenzvolumeter
(Abb. 12.31 d) sind einmal jährlich auf dem Kalibrierprüfstand zur Kalibrierung
der Mastervolumeter einzusetzen. Jeder Prüfling ist nach der Fertigung und Mon-
tage oder bei einer Neukalibrierung mit diesen Mastervolumetern zu kalibrieren.
Um die je nach Baugröße unterschiedlichen Durchflüsse abzudecken, werden
Masterzähler unterschiedlicher Baugröße verwendet. So saugen z. B. bei der Fir-
ma KRAL die laufenden Pumpen das Medium aus einem Tank an. Je nach Bau-
größe wird ein Ventil geschaltet, das das Prüfmedium über den Masterzähler und
den direkt danach eingebauten Prüfling wieder zurück in den Tank fördert.
Die Bereitstellung eines konstanten Volumenstromes ist die Grundvoraussetzung
für die Kalibrierung von Volumenstromsensoren. Dazu gibt es verschiedene
Möglichkeiten, wobei die gebräuchlichsten in Abb. 12.31 vorgestellt sind. So wird
z. B. ein Hydraulikzylinder mit konstanter Geschwindigkeit eingefahren und dabei
das vom Zylinder verdrängte Öl als Bezugsgröße verwendet. Vorraussetzung
dafür sind die Kenntnis der geometrischen Daten des Zylinders, die exakte
Messung des Hubweges und der Zeit. Aus den Daten kann der Vergleichswert
berechnet werden, der als Kalibrierbasis für den zu prüfenden Sensor dient. Durch
Variation der Öltemperatur und gegebenenfalls der Ölsorte, kann die Viskosität
variiert werden. Der mechanische Antrieb des den Volumenstrom bereitstellenden
Zylinders muss mit konstanter Geschwindigkeit erfolgen. Das kann mittels eines
geregelten Elektromotors und einem Spindelantrieb (Abb. 12.31 a) realisiert
werden.
Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung eines separaten Pneumatik-
zylinders, der von einem geregelten konstanten Gasdruck angetrieben wird (Abb.
12.31 c). Der Pneumatikzylinder arbeitet so mit konstanter Geschwindigkeit und
treibt mechanisch den Hydraulikzylinder an. Eine weitere Variante ist in Abb.
12.31 d dargestellt, wo eine mittels einer Pumpeneinheit (Schraubenspindel-
pumpe) eine konstante Drehzahl unter Verwendung von Frequenzumrichtern
realisiert wird.
Mehrere Kalibrierpunkte sind so auszuwählen, dass der Messbereich jedes Prüf-
lings abgedeckt wird. Damit kann die Linearität der kalibrierten Volumeter er-
mittelt werden. Durch den direkten Vergleich der bekannten Kalibrierwerte des
Masterzählers werden die Kalibrierwerte des Prüflings errechnet. Aus den fünf
Messpunkten mit den höheren Durchflüssen wird ein arithmetischer Mittelwert
gebildet, der den resultierenden K-Faktor ergibt. Der K-Faktor wird in P/l (Pulsen
pro Litern) angegeben. Die gesamte Kalibrierung wird automatisch von der Prüf-
standssteuerung durchgeführt.
.
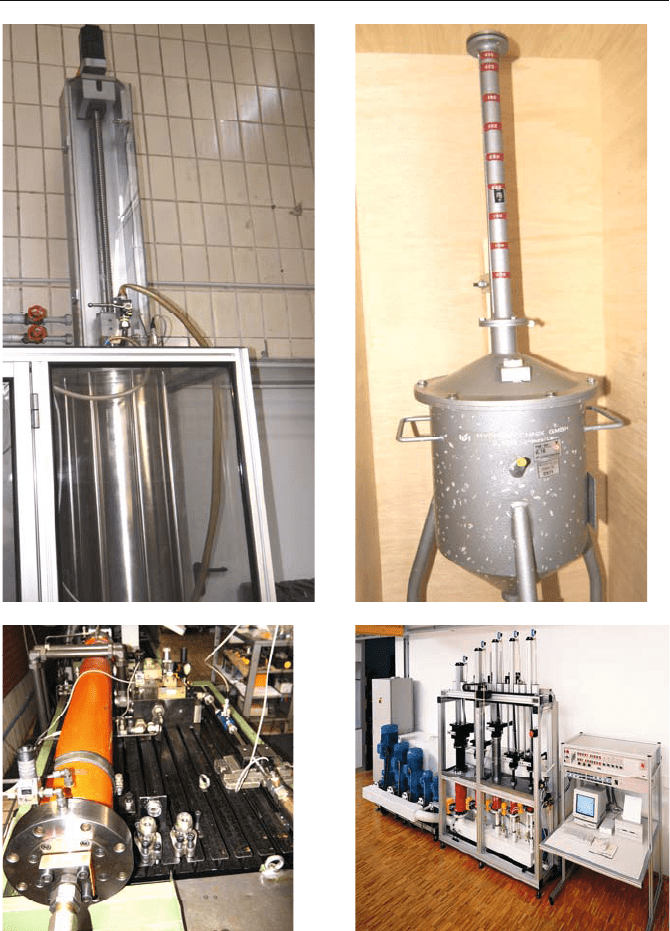
12.1 Messgrößen 371
a
b
c
d
Abb. 12.31 Kalibrierung von Volumenstromsensoren. a Bereitstellung des Volumen-
stromes durch Zylinder mit Spindelantrieb (Hydrotechnik) b Kalibrierter Messbehälter
(Hydrotechnik) c Bereitstellung des Volumenstromes durch Hydraulikzylinder mit
pneumatischen Antriebszylinder (Hydrotechnik) d Prüfstand mit Schraubenspindelantrieb
und kalibrierten Mastervolumeter (KRAL)
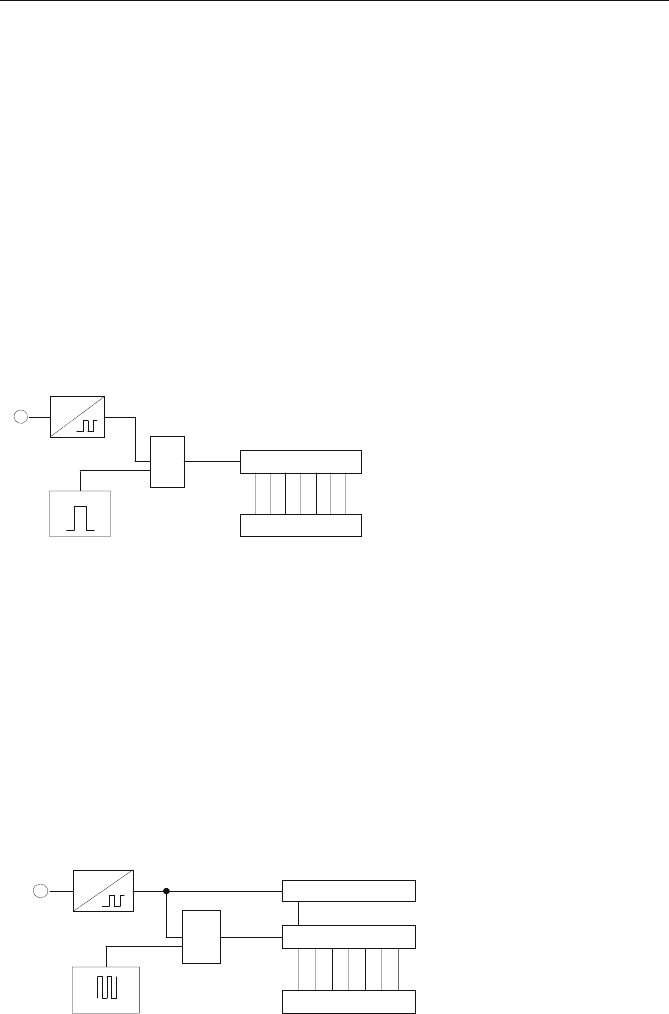
372 12 Messtechnik in der Hydraulik
12.1.6 Drehzahl
Die Drehzahlmessung kann mit analogen oder digitalen Sensoren erfolgen. Zur
ersteren Kategorie gehören Tachogeneratoren, die als permanenterregte Gleich-
spannungsgeneratoren oder als Wechselspannungsgeneratoren ausgeführt werden.
Beim Gleichspannungsgenerator ist die Klemmspannung proportional zur Dreh-
zahl. Wechselspannungsgeneratoren erfordern eine Auswertung der Amplitude
oder der Frequenz der Klemmspannung. Die praktische Anwendung scheitert oft
am fehlenden freien Wellenende zur mechanischen Kopplung.
Die
digitale Drehzahlmessung erfolgt häufig, indem ein Sensorelement, das
eine Lichtquelle und einen Lichtempfänger beinhaltet, in der Nähe einer
rotierenden Welle angeordnet wird. Auf der Welle selbst werden eine oder
mehrere Reflexionsmarken angebracht, so dass pro Umdrehung der ausgestrahlte
Lichtstrahl ein- oder mehrmals reflektiert wird. Neben optischen Signalgebern
können auch kapazitive oder induktive Geber verwendet werden.
&
Anzeige
Zähler
Ux
Torzeit
~
Abb. 12.32 Prinzip der Frequenzmessung
Die zugehörige Messwertverarbeitung gemäß Abb. 12.32 zählt während einer
bekannten Torzeit (konstanter Referenzoszillator) die Anzahl der Nulldurchgänge
des Drehzahlsignals
U
x
mit unbekannter Frequenz. Der Zählerstand ist proportio-
nal der gesuchten Frequenz. Für eine Torzeit von 1s entspricht der Zählerstand der
gesuchten Frequenz in Hz (
Frequenzmessung).
Eine andere Möglichkeit ist in Abb. 12.33 mit der
Periodendauermessung dar-
gestellt
. Dabei wird aus dem Drehzahlsignal ein Torsignal entsprechend seiner
Periodendauer erzeugt, das den elektronischen Zähler freigibt. Während dieser
Zeit werden die Impulse eines Oszillators mit bekannter Frequenz gezählt. Der
Kehrwert der Anzahl der gezählten Impulse ist proportional der gesuchten Dreh-
zahl [12.5, 12.11].
Abb. 12.33 Prinzip der Periodendauermessung
&
Anzeige
Zähler
Ux
Oszillator
~
Reset-Logik
T = 1 / f
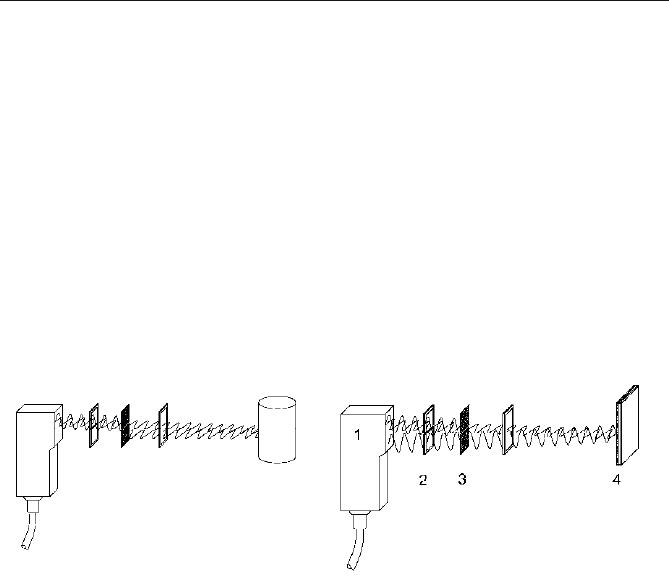
12.1 Messgrößen 373
Beide Verfahren unterscheiden sich grundlegend, sind aber gleichberechtigt
möglich. Für den Anwender werden diese Aufgaben durch die eingesetzte Hard-
ware realisiert. Er hat lediglich die Anzahl der Reflexionsmarken einzugeben, um
eine einheitengerechte Anzeige in min
-1
zu erhalten. Bei sehr langsam ablaufenden
Vorgängen ist gegebenenfalls die Abtastrate zu berücksichtigen, da einige Senso-
ren bei Unterschreitung einer unteren Grenzfrequenz automatisch in eine andere
Abtastrate umschalten.
Der in Abb. 12.34 dargestellte Drehzahlsensor [12.49] arbeitet nach dem opti-
schen Reflexionsverfahren. Der Sensor erzeugt mit Hilfe einer integrierten
Leuchtdiode pulsierendes Rotlicht. Durch einen vorgelagerten Polarisationsfilter
wird eine bestimmte Schwingungslage in Richtung Reflexionsmarke ausgesandt.
An dieser kommt es zu einer Drehung um 90° in Richtung Sender-
/Empfängereinheit. Der zu empfangende Rotlichtstrahl gelangt durch den Polari-
sationsfilter, wodurch die Störanfälligkeit aufgrund unerwünschter Strahlung
vermieden wird.
a b
Abb. 12.34 Funktionsprinzip eines Drehzahlsensors (Hydrotechnik) a ohne Reflexions-
marke b mit Reflexionsmarke 1 Sender/Empfänger, 2 Linse, 3 Polarisationsfilter,
4 Reflexionsmarke
12.1.7 Schallpegel
Die Reduzierung von Lärm ist eine generelle Aufgabe, die auch bei hydraulischen
Antrieben zu beachten ist. Die Arbeits- und Funktionsweise hydraulischer
Systeme macht diese besonders anfällig gegenüber Lärmemission. Um wirksame
Maßnahmen zu Entstehung und Ursachen des Geräuschpegels hinsichtlich einer
sinnvollen Verminderung einleiten zu können, müssen Messungen durchgeführt
werden, die die Größenordnungen verdeutlichen.
Bei dem als Lärm empfundenen Luftschall handelt es sich um Druck-
schwankungen der Luft, verbunden mit einer Schwingung der Luftteilchen in
einem Frequenzbereich von 20 – 20000 Hz. Für die Hydraulik ist vornehmlich der
hörbare Bereich relevant [12.18].
Der
Luftschall kann auf unterschiedliche Art entstehen:
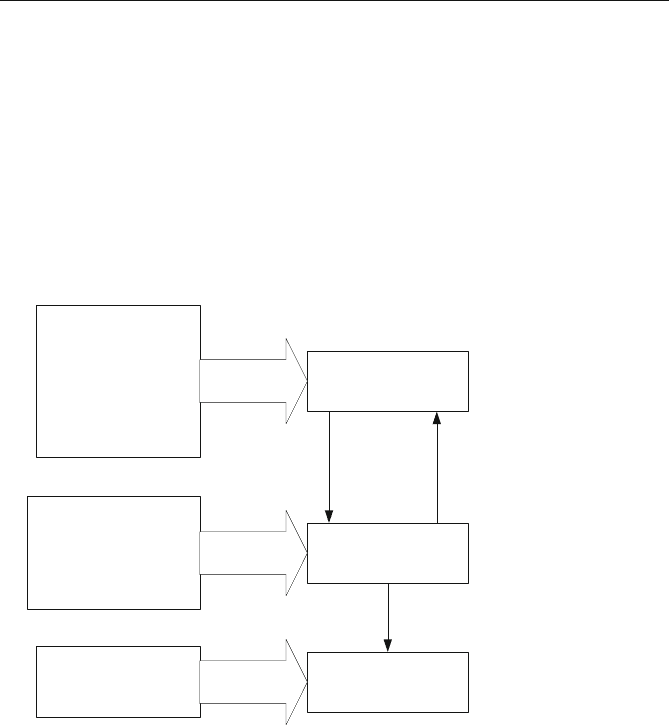
374 12 Messtechnik in der Hydraulik
Das Geräusch hydraulischer Anlagen entsteht meist über den Körperschall,
d. h. Schwingungen, die innerhalb der Komponenten übertragen werden, pflan-
zen sich über die Oberfläche in der umgebenden Luft fort.
Die Luft kann auch durch direkte Schwingungen angeregt werden, z. B. Lüfter-
räder.
Ursache des
Körperschalls sind Wechsellasten, d. h. in Betrag, Richtung oder
Angriffspunkt nicht konstante Kräfte oder Drehmomente. Diese Problematik muss
gemäß obiger Ausführungen sowohl für die Frequenz selbst (Drehzahl-
schwankungen des Antriebsmotors), als auch mit den damit verbundenen Aus-
wirkungen auf den Körperschall berücksichtigt werden.
Druckwechsel
Druckpulsation
Kavitation
Strömungsgeräusch
Schaltstoß
...
Flüssigkeitsschall
Druckwechsel
Mechanischer Stoß
Unwucht
Zahneingriff
...
Lüfterbewegung
...
Körperschall
Luftschall
Abb. 12.35 Geräuschentstehung und -übertragung
In der Hydraulik sind vor allem Volumenstrom- und Druckpulsationen zu be-
rücksichtigen, die sich als
Flüssigkeitsschall im Leitungssystem ausbreiten. Die
Druckpulsationen wirken als Wechselbelastungen auf die umgebenden Kompo-
nenten und führen so ebenfalls zur Körperschallanregung. Der Flüssigkeitsschall,
wie er in hydraulischen Systemen auftritt, hat verschiedene Ursachen. Die wich-
tigste darunter ist in den meisten Fällen der ungleichförmige Fördervorgang der
Verdrängereinheiten. Natürlich können auch Komponentenschwingungen zu Flüs-
sigkeitsschwingungen führen. Aber auch Kavitationserscheinungen, wechselnde
Druckbeaufschlagung, Strömungsrauschen und nicht zuletzt Schaltvorgänge an
Ventilen führen zu Druckschwankungen im System und damit zu Flüssigkeits-
schall. Dieser gesamte äußerst heterogene Prozess ist in Abb. 12.35 in seiner
Wechselwirkung dargestellt [12.19].
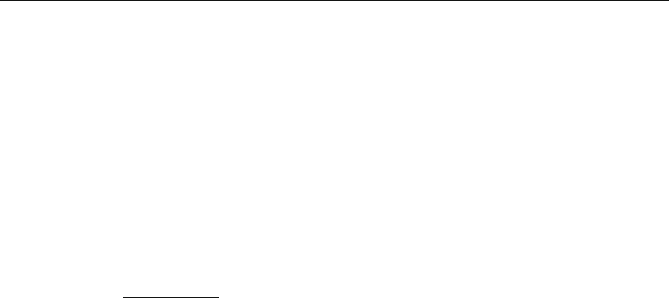
12.1 Messgrößen 375
Aus der Notwendigkeit heraus, die Lautstärke von Schallereignissen an ver-
schiedenen Orten zu unterschiedlichen Zeiten vergleichen zu können, wurden
objektive Messverfahren entwickelt.
Eine wichtige Kenngröße ist der frequenzbewertete Schallpegel des Schall-
wechseldruckes, wobei die Bewertung nach bestimmten Frequenzkurven erfolgt.
Da der Höreindruck des Menschen zusätzlich frequenzabhängig ist, wobei sich
z. B. altersbedingt der hörbare Bereich verkleinert (16 Hz...16 kHz), wird die
gemessene Größe mit einer frequenzabhängigen Korrektur beaufschlagt. Damit
ergibt sich die sog. A-Bewertung (Angabe dB(A)). Der Schallpegel
L berechnet
sich gemäß Gl. (12.28)
bar
p
L
eff
10
102
log20
in dB(A). (12.28)
Überlagern sich Geräusche mehrer Schallquellen, so werden nicht die Pegel
sondern die Schallleistungen bzw. die Quadrate der Schalldrücke addiert.
Die Schallintensität ist dagegen definiert als Schallleistungsfluss durch eine
Einheitsfläche, die senkrecht zur Messeinrichtung steht, d. h. eine vektorielle
Größe, der neben einem Betrag auch eine Richtung zuzuordnen ist. Somit lässt
sich die Richtung der Schallausbreitung feststellen und eine Schallquelle orten.
Bei vor- und zurücklaufenden Schallwellen, wie sie z. B. durch Reflexion ent-
stehen, wird durch die Schallintensitätsmessung nur der mittlere Energiefluss
erfasst. Daher wird für die Messung kein spezieller Schallmessraum benötigt.
Neben der objektiven Beurteilung werden zunehmend auch subjektive Eindrücke
herangezogen. So kann z. B. ein Geräusch einmal durch seine Lautstärke, zum
anderen aber auch durch seine Lästigkeit charakterisiert werden, wobei beide
Begriffe grundsätzlich auseinander zu halten sind. Mit der Lautstärke eines Ge-
räusches nimmt oft auch seine Lästigkeit zu. Beispielsweise wird bei zwei Ge-
räuschen mit ähnlichen Frequenzverteilungen das lautere als unangenehmer
empfunden. Im Gegensatz dazu kann bei zwei ganz verschiedenen Geräuschen das
leisere unter Umständen lästiger wirken als das lautere. Beim Zusammenwirken
zweier Geräusche kann der Lästigkeitseindruck sogar abnehmen, sofern ein
lästiges Geräusch durch ein anderes, weniger lästiges Geräusch verdeckt wird.
Daraus folgt, dass zur Charakterisierung der Lästigkeit nicht nur die Lautstärke
maßgeblich ist, sondern es müssen weitere physikalische und psychologische
Kriterien wie die Frequenzverteilung, die Zeitdauer der Einwirkung, der Pegelver-
lauf über der Zeit, die seelische Verfassung des Belästigten, seine persönliche
Beziehung zum Geräusch und ähnliche Kriterien herangezogen werden [12.20].
Aus [12.21] ist bekannt, dass der Geräuschpegel in verschiedenen Messräumen
um bis zu 5 dB(A) streuen kann. Ursachen sind vor allem unterschiedliche Auf-
spannungen, Anordnungen und Ausführungen von Druck- und Saugleitungen
sowie von Lastventilen. Des Weiteren wirken sich Fertigungstoleranzen und Ein-
stellungstoleranzen auch im Geräusch von Pumpen aus. Unterschiede von
r 2 dB(A) innerhalb einer Baureihe können als normal betrachtet werden.
Schallpegelmesser gibt es in unterschiedlichen Modifikationen, die ausgehend
von der Erfassung des Schallpegels bis hin zur zeitgleichen Aufnahme der Mess-
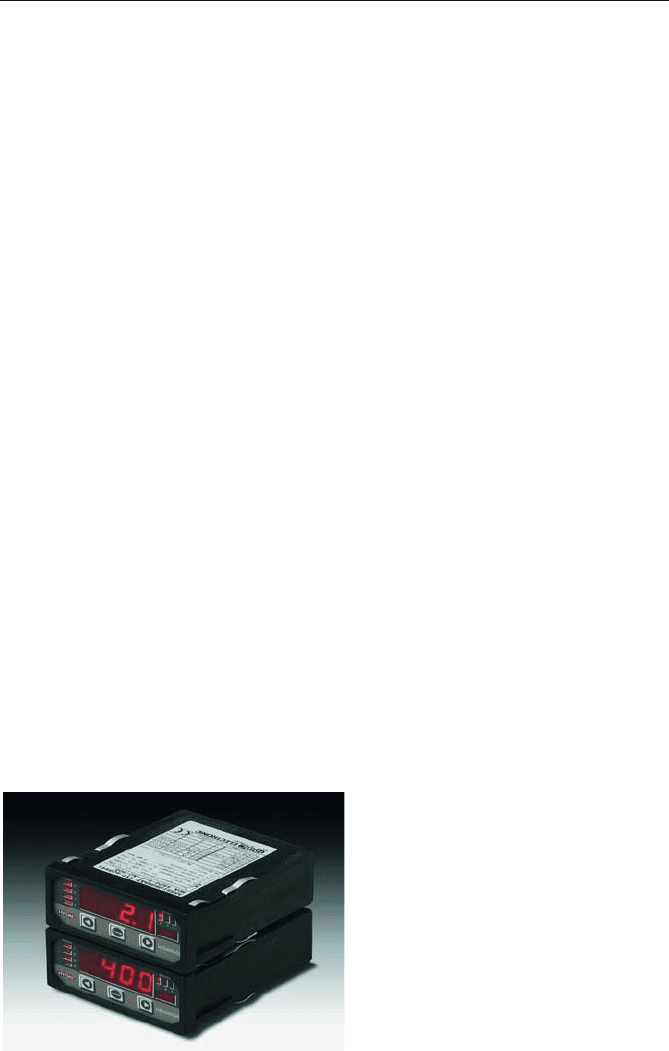
376 12 Messtechnik in der Hydraulik
werte in mehreren Frequenzbänder ermöglichen. Unter Einsatz von verschiedenen
Sensoren, wie Beschleunigungsaufnehmer, Messmikrofone oder Intensitätssonden
und umfangreiche Auswertesoftware sind sehr komplexe Messungen möglich. Da
diese Messungen ein eigenständiges Fachgebiet darstellen wird an dieser Stelle
auf die Spezialliteratur und einschlägige Firmen, wie z. B. Brüel & Kjaer ver-
wiesen.
12.2 Hydraulikmessgeräte
Die optimale Durchführung von Messaufgaben, sei es zur Grundeinstellung von
Maschinen und Anlagen oder für Diagnosezwecke, setzt nicht nur die Anbringung
von Sensoren voraus, sondern erfordert auch zugehörige Messgeräte. Die Ver-
bindung von Sensoren und Messgeräten erfolgt über abgeschirmte Messleitungen,
die gleichzeitig die Stromversorgung sichern und die Ausgangssignale der
Sensoren aufnehmen. Die Messgeräte selbst weisen einen unterschiedlichen Stand
auf, der von der einheitengerechten Anzeige bis zur Messdatenspeicherung mit
anschließender grafischer Darstellung reicht. Moderne Hydrauliktester sind mit
einem eigenen Rechner ausgerüstet, der auch einen Datenaustausch mit anderen
PCs ermöglicht, wo die Messdaten dann weiterverarbeitet werden können [12.22].
12.2.1 Digitalanzeigegeräte
Diese Kategorie von Messgeräten wird für stationäre Aufgaben an Prüfständen zur
Überwachung von einzelnen Messgrößen eingesetzt. Die Stromversorgung erfolgt
mit 220 V Wechselspannung oder einer Gleichspannung von 12
V/24 V. Die ein-
heitengerechte Anzeige setzt voraus, dass das entsprechende Messgerät dem
Messbereich des Sensors angepasst wird. Komfortable Geräte können mit einer
Schnittstelle und einem PC so programmiert werden, dass die gewünschten Effek-
te, wie u. a. Grenzwertüberwachung von Messgrößen, möglich werden. Abbildung
12.36 zeigt ein oft in stationären Prüfständen eingesetztes Digitalanzeigegerät.
Abb. 12.36 Schalttafeleinbaugerät (HYDAC)
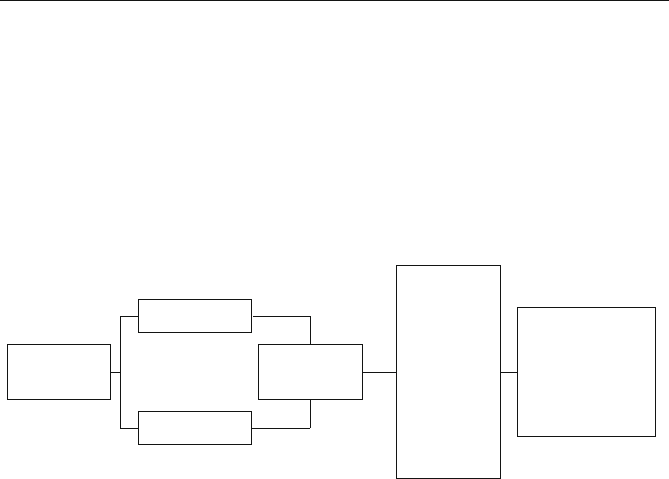
12.2 Hydraulikmessgeräte 377
12.2.2 Hydrotester
Hydrotester sind wesentlich komplexer als einfache Digitalanzeigegeräte aus-
geführt, da sie auch für umfassendere Messaufgaben verwendet werden. Ab-
bildung 12.37 zeigt den prinzipiellen Aufbau, der allen derartigen Messgeräten
eigen ist. Durch unterschiedliche Ausstattung des integrierten Rechners, des
Analog-Digital-Wandlers (ADU), der Speicherausstattung und des Grafikdisplays
ergeben sich in der Bedienung, der Messdatenverarbeitung, den speicherbaren
Messdaten und vor allem in der Möglichkeit der Anzeige der Messwerte beträcht-
liche Unterschiede.
Messverstärker
Analogeingang
Digitaleingang
Multiplexer/
ADU
Rechner,
Tastatur,
Grafikdisplay,
Speicher und
Software
Schnittstelle
für
externe
Datenübertragung
Abb. 12.37 Blockschaltbild eines Hydrotesters
Hydrotester gibt es als einfache Handgeräte (Abb. 12.38) oder in sehr kompakter
Form mit internem PC und Grafikdisplays (Abb. 12.39). Alle Messgeräte zeichnen
sich mittlerweile durch eine einfache, oft menügeführte Steuerung aus. Die nach-
folgend dargestellten Bedienschritte sind zur effektiven Durchführung von Mess-
aufgaben notwendig:
Auswahl des Sensors mit zugehöriger Spannungsversorgung und Ausgangs-
signal,
Festlegung des Messbereiches bzw. Anzahl der Impulse pro Sensor,
Eingabe von Verstärkungsfaktoren oder Linearisierungstabellen pro Sensor,
Abtastrate,
Auswahl der anzuzeigenden Messgrößen,
Auswahl der zu speichernden Messgrößen,
Festlegung der Messzeit, Triggerung eines Messsignals oder manuelle Aus-
lösung,
Anzeige bzw. Übertragung der Messdaten auf PC.
Hochwertige Messgeräte, so wie das in Abb. 12.39 dargestellte Multisystem 8050
beinhalten die Möglichkeit einer Prüfablaufgenerierung und Prüfablaufsteuerung.
So können zahlreiche Programmkomponenten, die durch symbolische Bausteine
darstellbar sind, zu einem Ablauf verknüpft werden [12.31]. Eine Automatisierung
von Messaufgaben zur Diagnose, zur Fehlersuche oder zur Prozessüberwachung
ist damit Realität geworden [12.35].
