Will D., Gebhardt N. (Hrsg.) Hydraulik: Grundlagen, Komponenten, Schaltungen
Подождите немного. Документ загружается.


408 14 Projektierung und Gestaltung von Kreisläufen
Hauptbestandteile jedes Kreislaufes sind die Antriebe und die jeweilige hydrau-
lische Energiequelle (Volumenstromquelle oder Druckquelle). Als Antrieb wird
im Folgenden die Zusammenschaltung Verbraucher und zugehörige Steuerung
verstanden (in Tabelle 14.1 sind alle Antriebe strich-punktiert eingerahmt wor-
den). Antriebe setzen hydraulische in mechanische Leistung um. Die hydraulische
Leistung wird von einer Volumenstromquelle oder einer Druckquelle (die damit
nicht Bestandteil des Antriebes sind) erzeugt.
Das Kreislaufkonzept ist gekennzeichnet durch die speisende Energiequelle
und die Art der Steuerung:
Die Speisung der Arbeitszylinder und Hydromotoren eines Kreislaufs kann aus
Volumenstromquellen (der Volumenstrom der Quelle Q
VQ
ist näherungsweise
unabhängig von dem Druck, gegen den sie fördert) oder aus Druckquellen (der
Quellendruck p
DQ
ist näherungsweise unabhängig von dem Volumenstrom, mit
dem sie belastet wird) erfolgen (s. Abschn. 5.1). Die Volumenstromquellen
werden im offenen und im geschlossenen Kreislauf eingesetzt. Druckquellen
werden ausschließlich in offenen Kreisläufen eingesetzt, sie können einen kon-
stanten oder einen sich lastabhängig einstellenden Drucksollwert haben. Letzte-
re erfordern spezielle Lastdruckmessstellen in den Steuerventilen und eine
Auswerteschaltung zur Ermittlung des höchsten Lastdruckes (Abschn. 14.4).
Die Steuerung kann schaltend mit Hilfe konventioneller Wegeventile oder ste-
tig mit Stetigsteuerventilen erfolgen. Bei der Stetigsteuerung ist zu unter-
scheiden, ob sich die Steuerventile als hydraulische Widerstände im Haupt-
strom zum Verbraucher befinden (oft als Widerstandssteuerung bezeichnet)
oder dazu dienen, das Verdrängungsvolumen großer Verbraucher zu verstellen
(Verdrängersteuerung).
Speisung. In der geschichtlichen Entwicklung der Hydraulik spielt die klassische
Struktur eines Hydraulikkreislaufes Konstantpumpe Leitung Verbraucher eine
dominierende Rolle. Das hat vor allem folgende Ursache: Der Wandler mechani-
scher in hydraulische Leistung, die Pumpe, ist eine Volumenstromquelle. Werden
Antriebe von Volumenstromquellen gespeist (s. Tabelle 14.1, linke Spalte), so
sind bei mehreren gleichzeitig aktiven Antrieben mehrere Volumenstromquellen
erforderlich, wenn die Antriebe, und das ist der Normalfall, voneinander un-
abhängig gesteuert werden sollen (s. Abschn. 5.3). Sollen die Geschwindigkeiten
trotz der Verwendung von Konstantpumpen einstellbar sein, muss ein Teil des von
der Pumpe geförderten Volumenstroms am Verbraucher vorbei (Nebenschluss, s.
Abschn. 5.4.2) zum Behälter zurückgeleitet werden (Tabelle 14.1, linke Spalte
oben und Mitte). Das hat Drosselverluste in den Nebenschluss- oder Bypasswider-
ständen zur Folge. Keine prinzipbedingten Drosselverluste im Hauptstrom treten
auf, wenn die Verdrängungsvolumina der Pumpe und/oder des Verbrauchers ver-
änderbar sind und so die geforderte Geschwindigkeit/Drehzahl eingestellt wird
(Tabelle 14.1, linke Spalte unten, Unterschiede zwischen offenem und ge-
schlossenem Kreislauf s. Abschn. 14.5.2.3).
Wird ein Kreislauf nach dem Konzept der Druckquelle mit konstantem Soll-
wert aufgebaut (s. Tabelle 14.1, mittlere Spalte), kann eine Druckquelle

14.2 Kreislaufkonzepte 409
(p
DQ
| konst.) mehrere gleichzeitig aktive Antriebe versorgen. Diese müssen aber
einen genügend hohen hydraulischen Widerstand R
h
besitzen, damit sie zulässige
Geschwindigkeiten/Drehzahlen nicht überschreiten und sich nicht gegenseitig be-
einflussen, indem sie der Druckquelle so hohe Volumenströme entziehen, dass der
Druck zusammenbricht. Das wird mit Hilfe von Stromventilen im Zulauf oder im
Ablauf (Tabelle 14.1, mittlere Spalte oben) oder mit Hilfe von Stetigsteuerventilen
(Tabelle 14.1, mittlere Spalte Mitte) erreicht, in denen Drosselverluste entstehen.
Ist der Lastdruck niedrig, fällt nahezu der gesamte Druckquellendruck p
DQ
über
diesen Ventilen ab; bei zusätzlich großen Volumenströmen zum Verbraucher kann
die Verlustleistung sehr groß werden. Verbraucher, die große mechanische Leis-
tungen abgeben müssen, werden deshalb nach Möglichkeit direkt an eine Druck-
quelle angeschlossen (Tabelle 14.1, mittlere Spalte unten). Der erforderliche hy-
draulische Widerstand R
h
wird mit Hilfe der Anpassung des Verbraucherverdrän-
gungsvolumens an den aktuellen Lastdruck erzeugt. Das erfolgt durch einen Hilfs-
antrieb, in den meisten Fällen innerhalb einer Geschwindigkeits-/Drehzahlrege-
lung. Für dieses Prinzip der Regelung ist in der Hydraulik der Begriff der Sekun-
därregelung geprägt worden. Der Aufwand an Komponenten ist hoch. Zudem ent-
stehen relativ große Leckverluste, wenn die Lastdrücke im Verhältnis zum Druck-
quellendruck klein sind. Beachtet werden muss, dass die stetige Verdrängersteue-
rung eines Verbrauchers nur bei Hydromotoren mit einstellbarem Verdrängungs-
volumen möglich ist. Ist der Verbraucher ein Arbeitszylinder, muss ein Hydro-
transformator zwischengeschaltet werden (s. Abschn. 14.3.3).
Eine besondere Stellung nimmt die Speisung aus einer Druckquelle mit last-
druckabhängiger Veränderung des Drucksollwertes ein (rechte Spalte, Mitte). Die
Widerstandssteuerung (wie in Tabelle 14.1, mittlere Spalte, Mitte) bleibt erhalten,
aber die Drosselverluste werden in Grenzen gehalten, indem der Druckquel-
lendruck auf den höchsten Lastdruck (zuzüglich einer für die Steuerventile not-
wendigen Druckdifferenz) abgesenkt wird. Für diese Messung und Verarbeitung
des Lastdruckes ist der Begriff Load-Sensing-System (LS-System) eingeführt
worden. Um mehrere Antriebe an diese Druckquelle anschließen zu können, müs-
sen diese wegen der möglichen starken Quellendruckschwankungen mit einer Ge-
schwindigkeits-/Drehzahlregelung oder mit einer Volumenstromregelung aus-
gerüstet sein (z. B. Druckdifferenzventile, sog. Druckwaagen, in Verbindung mit
Proportional-Wegeventilen, s. Abschn. 14.4). Dabei wird gesichert, dass in den
Antriebsregelungen wesentlich geringere Verzögerungen auftreten als in der
Druckregelung, die auf relativ langsames Folgeverhalten ausgelegt wird.
Steuerung. Die Steuerung besteht aus Ventilen zur Beeinflussung von Kraft und
Bewegung des Arbeitskolbens bzw. des Rotors des jeweiligen Verbrauchers nach
Betrag und Richtung. Ein Kennzeichen einer Steuerung ist, ob sie stetig oder un-
stetig arbeitet. Unstetig arbeitende Steuerungen enthalten als wesentliche Steuer-
elemente konventionelle Wegeventile, die nur zwei oder drei diskrete Steuer-
funktionen besitzen, indem Volumenströmen Wege versperrt bzw. freigegeben
werden. Sie dienen vor allem der Richtungsvorgabe von Bewegungen. Die Größe
der Geschwindigkeiten wird mit Hilfe von Stromventilen eingestellt. Stetig arbei-
tende Steuerungen enthalten als wesentliche Steuerelemente Stetigsteuerventile
wie Servoventile, Proportional-Wegeventile oder, häufig in der Mobilhydraulik,
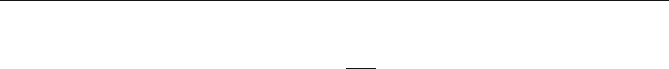
410 14 Projektierung und Gestaltung von Kreisläufen
handbetätigte feinfühlig verstellbare Wegeventile. Mit Hilfe mehrerer stetig ver-
stellbarer Drosselstellen können Richtung und
Betrag der Volumenströme von ein
und demselben Ventil gesteuert werden. Wenn diese Stetigventile in den Volu-
menstrom zum Verbraucher eingreifen, sich also im Hauptstrom befinden, kann
von widerstandsgesteuerten Stetigantrieben gesprochen werden. Wird mit ihrer
Hilfe der Verbraucherparameter Verdrängungsvolumen verändert, entsteht ein
verdrängergesteuerter Stetigantrieb.
Schaltend (die Komponenten sind billiger) kann die Steuerung vor allem in sel-
ten umzurüstenden Einzweckmaschinen wie Sondermaschinen, Taktstraßen oder
einfachen Hubbühnen ausgeführt werden. Es kommen nur wenige Kreislauf-
strukturen in Frage (Tabelle 14.1, oben). Bei stetiger Steuerung ist die Struktur-
vielfalt deutlich größer. Entscheidend für die Wahl der Energiequelle und die Art
der Stetigsteuerung ist, welche mechanischen Leistungen die einzelnen Antriebe
abzugeben haben.
Antriebe. Die Antriebe bestehen aus Verbraucher und Steuerung. Verbraucher
sind Arbeitszylinder und Hydromotoren; sie setzen die hydraulische in mechani-
sche Leistung um. In Tabelle 14.2 wurde eine Einteilung in typische Antriebs-
gruppen vorgenommen.
Hauptunterscheidungsmerkmal ist die abzugebende mechanische Leistung ei-
nes Antriebes. Von der Abgabe einer geringen durchschnittlichen Leistung, durch
die der Nebenantrieb charakterisiert wird, kann gesprochen werden, wenn der An-
trieb bei den in der Hydraulik typischen großen Belastungskräften/-momenten
entweder innerhalb eines Zyklus nur kurzzeitig zugeschaltet ist oder sehr geringe
Geschwindigkeiten über längere Zeit entwickelt. Typisches Beispiel ist der Vor-
schubantrieb; seine Eilgänge sind meist kurz, der Arbeitsgang erfolgt bei sehr
kleinen Geschwindigkeiten, während der Hilfsprozesse bewegt er sich nicht.
Die Aufgabenstellung legt im Prinzip fest, welche Kreislaufkonzepte in der zu
projektierenden Hydraulikanlage zur Anwendung kommen. Die geforderten tech-
nischen Parameter sind bei niedrigstmöglichen Kosten für die Anschaffung und
für das Betreiben der Hydraulikanlage zu erfüllen. Erste Schlussfolgerungen sind:
Antriebe mit geringer durchschnittlicher Leistungsabgabe können von einer
gemeinsamen Druckquelle (Kostenvorteil bei der Anschaffung) versorgt und
von Steuerventilen im Hauptstrom gesteuert werden.
Antriebe mit hoher durchschnittlicher Leistungsabgabe sollten verdränger-
gesteuert werden, um große Drosselverluste und damit hohe Betriebskosten zu
vermeiden. Die Energiequelle kann dabei eine Druckquelle (Sekundärregelung
der Antriebe) sein, oder es ist je eine Volumenstromquelle für jeden Antrieb
einzusetzen.
Die Struktur wird aber auch davon beeinflusst, welche Anforderungen an das dy-
namische Verhalten eines Antriebs gestellt werden. Die Kennwerte der Dynamik
Eigenfrequenz und Eigenzeitkonstante werden vor allem von den zu bewegenden
Massen und von Größe und Begrenzung der unter veränderlichem Druck stehen-
den Volumina bestimmt.
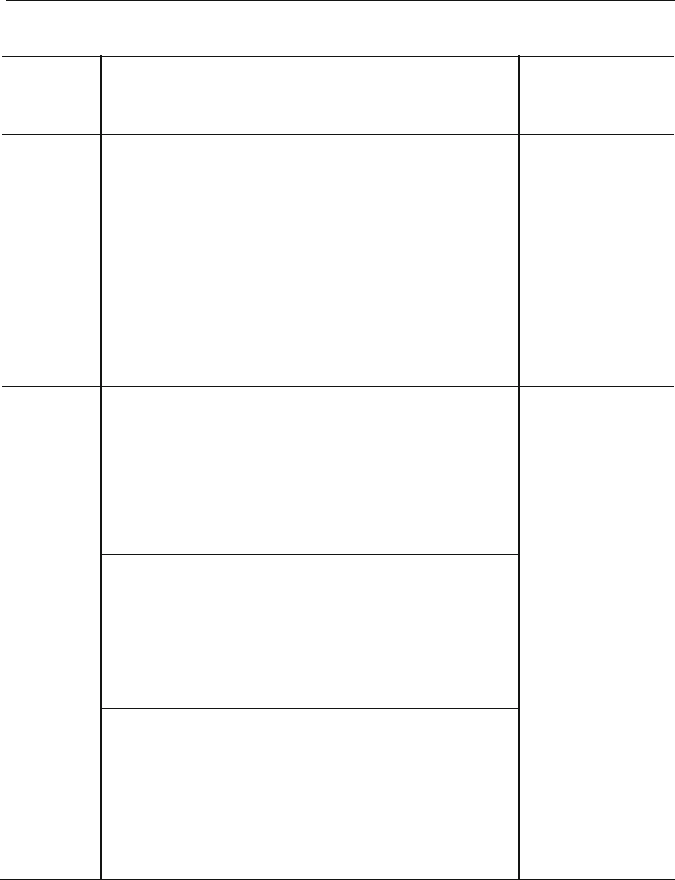
14.2 Kreislaufkonzepte 411
Tabelle 14.2 Einteilung der Antriebe
Gruppe Art/Ver-
brau-
cher
Aufgabe
(vorrangig)
Reagieren auf
äußere Ein-
flüsse
Typische Kreis-
laufkonzepte
Hauptan-
trieb: Ab-
gabe ho-
her me-
chani-
scher Lei-
stungen
über län-
gere Zeit
Lei-
stungs-
antrieb/
Hydro-
motor
oder Ar-
beits-
zylinder
Realisierung von
Dreh- bzw. trans-
latorischen Be-
wegungen gegen
große Momen-
te/Kräfte über längere
Zeit (Beispiele: Fahr-
antriebe, Winden-
antriebe, hydrostati-
sche Getriebe,
Aufzüge, Umform-
maschinen)
Das Last-
moment bzw.
die Belastungs-
kraft nimmt
vielfach Ein-
fluss auf die
Drehzahl/Ge-
schwindigkeit
im Sinne einer
Leistungs-
begrenzung.
Volumenstrom-
quelle
*)
, Ver-
drängersteuerung
Druckquelle und
Sekundärregelung
Load-Sensing-
System
*)
Nebenan-
trieb:
Niedrige
durch-
schnitt-
liche Lei-
stungs-
abgabe
Positi-
onsan-
trieb/
meist
Arbeits-
zylinder
Anfahren und Halten
von Positionen, Reali-
sierung vorgegebener
Weg-Zeit-Funktionen
(Beispiel: Werkstück-
handhabung)
Äußere Kräfte
dürfen keinen
merklichen Ein-
fluss auf die Po-
sitionen haben.
Druckquelle und
Widerstandssteue-
rung der Antriebe
Ge-
schwin-
digkeits-
antrieb/
meist
Arbeits-
zylinder
bestimmte Wegeber-
eiche mit vor-
gegebenen kleinen
Geschwindigkeiten
durchfahren (Beispiel:
Vorschubbewegung)
Äußere Kräfte
dürfen keinen
merklichen Ein-
fluss auf die Ge-
schwindigkeit
haben.
Kraft-
antrieb/
meist
Arbeits-
zylinder
Ausüben einer vor-
gegebenen Kraft auf
die angekoppelten An-
lagenteile (Beispiele:
Spannen, Gewichts-
ausgleich)
Verbraucherbe-
wegungen dür-
fen keinen
merklichen Ein-
fluss auf die
Kraft haben.
*)
oft in Ver-
bindung mit
Druck-
abschneidung und
Leistungsregelung
Die zu bewegenden Massen liegen mit der Aufgabenstellung im Prinzip fest.
Die unter veränderlichem Druck stehenden Volumina sind relativ groß (und die
Federn nachgiebig) bei Speisung aus Volumenstromquellen, sie können klein ge-
halten werden bei Speisung aus Druckquellen in Verbindung mit Steuerventilen
im Hauptstrom (s. Abschn. 14.4.3 und 14.4.4). Hohe Ansprüche an das dynami-
sche Verhalten mehrerer Leistungsantriebe führen damit häufig zur Load-Sensing-
Struktur, mit deren Hilfe die Drosselverluste gegenüber der Speisung aus einer
Druckquelle mit konstantem Sollwert abgesenkt werden können.

412 14 Projektierung und Gestaltung von Kreisläufen
Diese Schlussfolgerungen sind in der rechten Spalte der Tabelle 14.2 zu-
sammengefasst. Mit Hilfe von Bilanzen der Verlustleistungskosten über
repräsentative Zeiträume und Vergleich mit Anschaffungskosten können kosten-
optimale Strukturen ermittelt werden (s. Abschn. 14.6). Bei der Projektierung
einer Hydraulikanlage sollte wie folgt vorgegangen werden (s. Abschn. 14.7):
1. Die Nebenantriebe und weitere Antriebe mit kleiner durchschnittlicher Aus-
gangsleistung werden widerstandsgesteuert (Steuerventile im Hauptstrom) und
werden von einer Druckquelle gespeist. Hier erübrigt sich oft ein wirtschaft-
licher Vergleich.
2. Die Leistungsantriebe werden nach den typischen Konzepten strukturiert und
anschließend einem Vergleich der technischen und der wirtschaftlichen Para-
meter unterzogen: als sekundärgeregelte Antriebe, die an die ohnehin erforder-
liche Druckquelle oder eine eigens zu schaffende angeschlossen werden, als in
ein Load-Sensing-System integrierte Antriebe oder als Antriebe, die aus je ei-
ner Volumenstromquelle gespeist werden.
Von dieser Reihenfolge ausgehend, werden in den nächsten Abschnitten zunächst
Kreisläufe mit Druckquelle und danach solche mit Volumenstromquellen be-
schrieben.
14.3 Kreisläufe mit Druckquellen konstanten
Drucksollwertes
14.3.1 Kreislaufstrukturen, Teilsysteme
Diese Kreislaufstruktur ist mit der eines elektrischen Gleichstromsystems ver-
gleichbar: Eine einzige Druckquelle versorgt mehrere zueinander parallel an-
geordnete Antriebe, ohne dass diese sich merklich gegenseitig beeinflussen (Abb.
14.1 a und b). Voraussetzung dafür ist, dass
der Druck der Druckquelle trotz unterschiedlichster Volumenstromabgabe an-
nähernd konstant bleibt,
alle Antriebe (sie bestehen aus Verbraucher und Steuereinrichtung) auf einheit-
lichen Druck ausgelegt worden sind und
die Volumenstromaufnahme der einzelnen Verbraucher auf geeignete Weise
(z. B. durch Strömungswiderstände) begrenzt wird.
Da die Energiequelle der Hydraulik, die Pumpe, eine Volumenstromquelle ist,
muss mit Hilfe einer Druckregelung eine Druckquelle geschaffen werden (s.
Abschn. 5.1.2): Die Pumpe muss im Zusammenwirken mit einer Steuereinheit ih-
ren Volumenstrom dem von den Antrieben geforderten anpassen können.
Die Querschnitte von Druckleitung P und Tankleitung T werden i. Allg. so di-
mensioniert, dass auch in großflächigen Anlagen vernachlässigbare Druckverluste
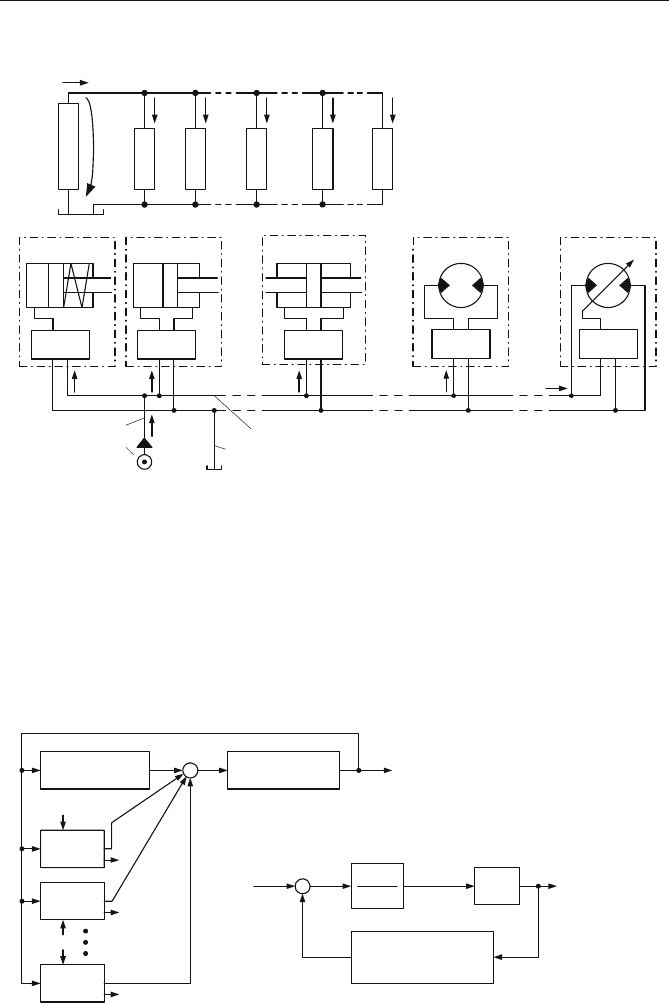
14.3 Kreisläufe mit Druckquellen konstanten Drucksollwertes 413
entstehen. Wird davon ausgegangen, dass an allen Stellen der Tankleitung der
Druck etwa null ist, dann ist das System nur über die Druckleitung verkoppelt.
a
Q
DQ
Q
Ak
Druckquelle
Antrieb n
Q
An
Antrieb l
Q
Al
Antrieb 1
Antrieb 2
Antrieb k
Q
A1
Q
A2
p
DQ
b
|
const
p
DQ
Q
Ak
Q
A2
Q
Al
St 1 St 2
St l
Druckquelle
Antrieb 1 Antrieb 2 Antrieb l
Q
DQ
St k
Antrieb k
P
T
Q
A1
Q
An
St n
Antrieb n
Abb. 14.1 Versorgung mehrerer Antriebe eines Hydraulikkreislaufes durch eine Druckquelle.
a Grobstruktur b detailliertere Darstellung
Der vielfach vor der Einmündung der Tankleitung in den Behälter angeordnete
Rücklauffilter wird so dimensioniert, dass kein das Verhalten des Kreislaufs we-
sentlich beeinflussender Druckabfall entsteht.
Wie sich die einzelnen Antriebe gegenseitig beeinflussen können, kann aus
dem Signalfluss in Abb. 14.2 a ersehen werden.
-
x
an
x
a1
x
a2
Q
A2
Q
An
-
-
x
e2
x
en
Q
A1
Q
gesp
x
e1
p
DQ
Antrieb 1
Antrieb 2
Antrieb n
Q
DQ
Speicher (plus
Druckleitung P)
Pumpe mit
Steuereinheit
1
C
hges
dt
³
p
DQ
6
Q
Ak
Q
DQ
-
Q
gesp
dp
DQ
/dt
Pumpe mit
Steuereinheit
a b
Abb. 14.2 Kopplungen in einem Kreislauf mit Druckquelle. a Signalfluss der gegenseitigen Be-
einflussung der Antriebe b Blockschaltbild der Regelung

414 14 Projektierung und Gestaltung von Kreisläufen
Wird z. B. der Antrieb 1 mit Hilfe des Eingangssignals x
e1
(das könnte eine
Wegeventilbetätigung sein) in seinem Bewegungszustand (gekennzeichnet durch
das Ausgangssignal x
a1
) verändert, hat das eine Veränderung seines Volumen-
stromes Q
A1
zur Folge, was zu einer Differenz zwischen dem geförderten und dem
geforderten Volumenstrom führt. Wird angenommen, Q
A1
werde kleiner, dann ist
die Differenz positiv, es wird Q
gesp
!
0. Das führt in den Kapazitäten Speicher und
Volumen der Druckleitung P zu einer Druckerhöhung. Der Druck erhöht sich da-
bei umso schneller, je kleiner die Gesamtspeicherkapazität von Speicher und
Druckleitung C
hges
ist.
Damit sich der Druck vor den Antrieben 2 bis n nicht merklich erhöht und da-
mit ihren Zustand beeinflusst, muss die Steuereinheit der Pumpe dafür sorgen,
dass in kürzestmöglicher Zeit der Volumenstrom Q
DQ
auf den erforderlichen Wert
zurückgeht, ohne dass sich der Druck p
DQ
bleibend merklich verändert hat (nur bei
Q
gesp
= 0 entsteht keine Druckänderung). Dass damit ein Druckregelkreis entsteht,
ist in Abb. 14.2 b zuerkennen (s. Abschn. 14.3.3).
Ein solcher Kreislauf kann in die Teilsysteme Antriebe, Druckquelle und Lei-
tungssystem unterteilt werden.
14.3.2 Antriebsschaltungen
14.3.2.1 Wegeventilgesteuerte Antriebe
Positionsantriebe. In Abb. 14.3 sind typische Varianten dieser Antriebe, die der
Realisierung vorgegebener Weg-Zeit-Funktionen dienen, dargestellt: das Fahren
gegen Festanschläge, driftfreies Anhalten zwischen den Endlagen des Arbeits-
kolbens und das relativ genaue Positionieren aus einem Schleichgang heraus.
Allen drei Antrieben gemeinsam ist:
Sie besitzen jeweils ein 4/3-Wegeventil, das die Zustände Rechtslauf, Linkslauf
(bzw. Vor- und Rücklauf) sowie Halt einzustellen erlaubt.
Die Antriebe enthalten alle ein nicht einstellbares Drosselventil VDr 1, ggf. zu-
sätzlich in Reihenschaltung mit einem einstellbaren. Das nicht einstellbare
Drosselventil legt den maximal möglichen Volumenstrom, der der Druckquelle
entnommen werden kann, fest. Es sollte in jeder Antriebsschaltung vorgesehen
werden, um keine die Druckquelle überlastende Volumenstromentnahme durch
unsachgemäßes Verstellen einstellbarer Stromventile zu riskieren. Wenn die
Druckquelle überlastet ist, bricht der Druck zusammen; die ganze Anlage kann
außer Tritt kommen. Die Suche eines solchen Fehlers ist oft sehr zeitauf-
wändig. Die Kosten für das Konstantdrosselelement können sehr gering ge-
halten werden, wenn entsprechende Blenden oder Düsen z. B. in die Wege-
ventilunterplatte eingebracht werden.
Alle Drosselventile sind zwischen Verbraucher und Tankleitung angeordnet
worden. Das hat den Vorteil, dass der Arbeitskolben beidseitig zwischen Druck-
kräften eingespannt ist und damit bei Abbremsvorgängen immer gegen eine Fluid-
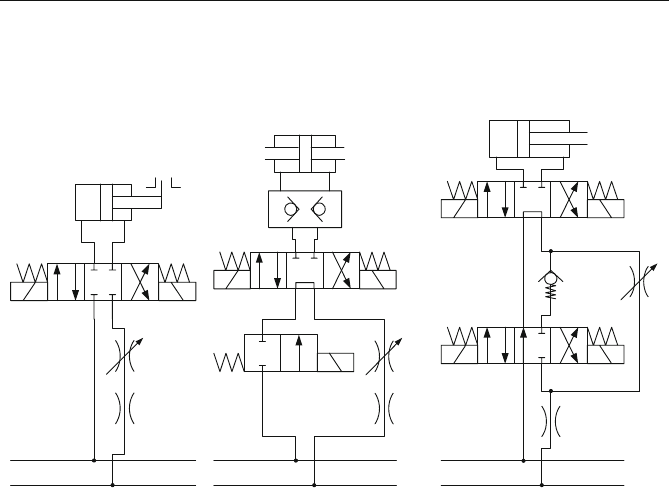
14.3 Kreisläufe mit Druckquellen konstanten Drucksollwertes 415
säule drückt. Bei senkrechten Antrieben ist das nicht erforderlich, da hier die Ge-
wichtskraft diese Rolle übernimmt (s. Abschn. 5.1.2).
VDr 1
VDr 2
P
T
102
VW 2
VW 1
P
T
102
1
2
VDr 1
VDr 2
VDr 1
VDr 2
VW 1
VW 2
P
T
102
1
02
a b c
Abb. 14.3 Wegeventilgesteuerte Positionsantriebe. a Fahren gegen Festanschläge b driftfreies
Anhalten zwischen den Endlagen des Arbeitskolbens c Positionieren aus einem Schleichgang
heraus
Das Fahren gegen Festanschläge ist mit einer sehr einfachen Schaltung möglich
(Abb. 14.3 a). Mit Hilfe von VDr 2 kann die Aufprallgeschwindigkeit eingestellt
werden. VDr 2 bestimmt aber auch die Geschwindigkeit zwischen den An-
schlägen. Es ist also möglicherweise ein Kompromiss zwischen Aufprallhärte und
Produktivität notwendig. Eine besondere Schwäche der Schaltung ist, dass ein
Anhalten zwischen den Anschlägen (mit Hilfe der Mittelstellungsfunktion des
Wegeventils prinzipiell möglich) fast immer zum Driften des Kolbens führt. Ursa-
che ist die nicht exakt dichtende Paarung Kolbenlängsschieber/Bohrung im We-
geventil.
Dieses ungünstige Verhalten kann vermieden werden, indem ein 2/2-Wegeven-
til vorgeschaltet und ein 4/3-Wegeventil mit anderer Mittelstellungsfunktion ge-
wählt wird (Abb. 14.3 b). In den gezeichneten Schaltstellungen dieser Ventile
wird zum einen die Druckquelle nicht belastet, zum anderen liegt kein Druck an
der beschriebenen Brückenschaltung an. Zusätzlich wird mit Hilfe eines Doppel-
rückschlagventils (s. Abschn. 8.3) ein Wegwandern des Kolbens unter der Ein-
wirkung äußerer Kräfte in beiden Richtungen vermieden.
Die Antriebsstruktur nach Abb. 14.3 c erlaubt relativ exaktes Positionieren mit
Hilfe einer Vorabschaltung auf einen Schleichgang und damit das Anhalten des
Antriebes aus einer sehr kleinen Geschwindigkeit heraus. Das 4/3-Wegeventil
VW1 hat die Aufgabe, neben der Realisierung der Driftfreiheit bei Stillstand
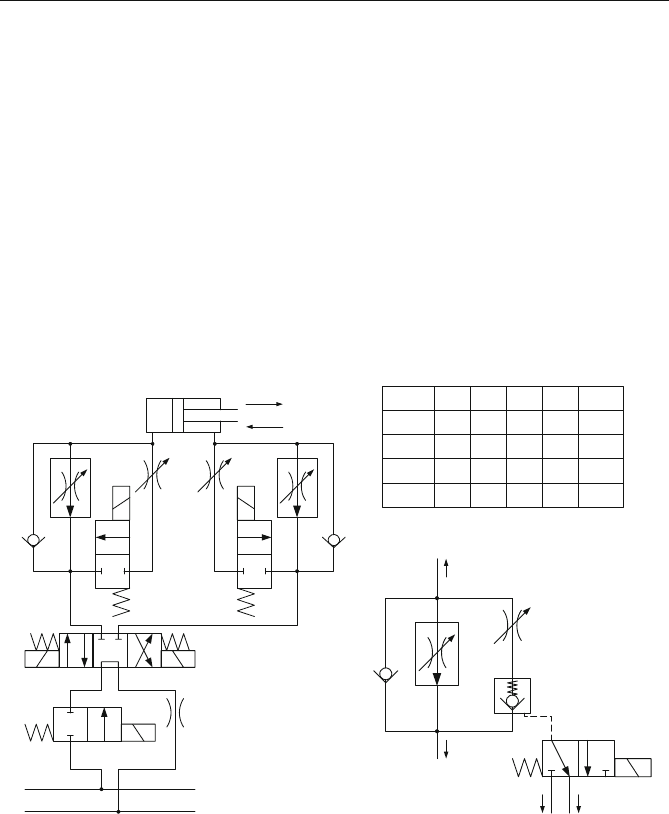
416 14 Projektierung und Gestaltung von Kreisläufen
(Schaltstellung 1) das Umschalten zwischen Normalgeschwindigkeit und
Schleichgang vorzunehmen (Schaltstellung 2: Normalgeschwindigkeit, da VDr 2
überbrückt ist; Schaltstellung 0: Schleichgang). Das gleichzeitige Einstellen der
Mittelstellungsfunktionen beider Wegeventile muss in der Ansteuerung der Ven-
tilmagnete verhindert werden (Verriegelung), da dann die Druckquelle belastet
würde, obwohl der Arbeitszylinder steht. Bei diesem Antrieb wurde angenommen,
dass relevante äußere Kräfte nicht auftreten.
Geschwindigkeitsantriebe. Im Vordergrund steht die Einhaltung einer bestimmten
Geschwindigkeit, wobei die abgegebene durchschnittliche Leistung klein ist. In
Abb. 14.4 a ist eine mögliche Schaltung eines solchen Antriebs angegeben. Für
Vor- und für Rücklauf sind die Eil- (VDr 2, VDr 3) und die Arbeitsgänge (VSZ 1,
VSZ 2) jeweils unabhängig voneinander einstellbar (s. Zusammenstellung der
Schaltstellungen der Wegeventile in Abb. 14.4 b).
a
P
T
VW 1
VW 2
VW 4 VW 3
VSZ 1 VSZ 2
VDr 3
VDr 2
VDr 1
EV, AV
ER, AR
1
2
1
2
102
12
b
c
VW 1
VW 4
VW 3
VW 2
EV HaltARERAV
12111
1
1
2
2
2211
1/2 1/2 1/2
1/2 1/2 1/2
0
12
P T
VSZ 1
VDr 2
VW 4
VW 2
Arbeits-
zylinder
Abb. 14.4 Wegeventilgesteuerter Antrieb mit vier Geschwindigkeiten. a Schaltplan b Wegeven-
tilschaltstellungen c Schaltungsmodifikation für sehr kleine Arbeitsgeschwindigkeiten EV Eil-
vorlauf, AV Arbeitsvorlauf, ER Eilrücklauf, AR Arbeitsrücklauf
Zusätzlich werden, wie schon zu Abb. 14.3 b erläutert, das Driften des Arbeits-
kolbens durch VW 1 in Verbindung mit der Mittelstellung von VW 2 und un-
kontrolliert hohe Volumenstromentnahme durch zu weit geöffnete einstellbare
Stromventile mit Hilfe von VDr 1 vermieden. Die Zwei-Wege-Stromregelventile
VSZ 1, VSZ 2 dienen der Arbeitsgangeinstellung, die einfachen Drosselventile
VDr 2, VDr 3 der Eilgangeinstellung. Aus dieser Schaltung sind einfachere abzu-

14.3 Kreisläufe mit Druckquellen konstanten Drucksollwertes 417
leiten. Wird z. B. Arbeitsrücklauf nicht gefordert, können die Komponenten VSZ 1
und VW 4 entfallen; in dem linken Zweig ist nur ein Drosselrückschlagventil er-
forderlich. Die Zwei-Wege-Stromregelventile sind oft angewendete Komponenten
in von einer Druckquelle versorgten Geschwindigkeitsantrieben. Neben den Vor-
teilen (s. Abschn. 8.2.2) hohe Regelgüte und geringe Verschmutzungsneigung
selbst bei sehr kleinen Volumenströmen (da zwei in Reihe liegende Strömungs-
widerstände, von denen einer veränderlich ist, den Gesamtwiderstand bilden) ha-
ben Antriebe mit Zwei-Wege-Stromregelventil den Nachteil des sogenannten An-
fahrsprunges. Beim Zuschalten des Stromregelventils ist der Drosselspalt seines
Druckdifferenzventils weit geöffnet.
Beim Einfahren des Ventilkolbens in Arbeitsstellung wird ein Volumen frei-
gegeben, das durch eine entsprechende Verschiebung des Arbeitskolbens im Ar-
beitszylinder aufgefüllt wird. Da der Vorgang sehr schnell abläuft, kommt er ei-
nem Positionssprung des Arbeitskolbens nahe.
In der Phase stationärer Geschwindigkeit führt diese Struktur dazu, dass eine
geringe Stick-Slip-Neigung auch im Bereich der Mischreibung des Arbeitskolbens
(fallende Reibkraftkennlinie, dF
R
/dv < 0) [14.4] auftritt.
Dass während des Eilgangs in Abb. 14.4 a ein Stromregelventil parallel zu dem
jeweiligen Drosselventil liegt, hat keinen nennenswerten Einfluss, da die Eilgang-
geschwindigkeit meist sehr viel größer als die Arbeitsganggeschwindigkeit ist. Es
darf aber nicht vorkommen, dass bei extrem niedrigen Arbeitsgeschwindigkeiten
der Volumenstrom durch das Stromregelventil in der Größenordnung des Leck-
volumenstroms durch das parallel liegende Wegeventil VW 3 oder VW 4 liegt, da
dann die Regelgüte stark abnimmt. Kolbenlängsschieberventile sind in diesem Fall
zu vermeiden, Sitzventile haben wesentlich bessere Dichteigenschaften. Nicht sel-
ten werden auch gut dichtende entsperrbare Rückschlagventile eingesetzt. Der lin-
ke Zweig für die Steuerung des Eil- und Arbeitsrücklaufs hätte dann das Aussehen
in Abb. 14.4 c. Das dann notwendige 3/2-Wegeventil als VW 4 kann, da nur das
entsperrbare Rückschlagventil steuernd, eine sehr kleine Nennweite haben. Es hat
in Verbindung mit dem entsperrbaren Rückschlagventil dieselbe Funktion wie
vorher VW 4 allein.
In Abb. 14.5 a ist eine Schaltplanvariante für einen Antrieb dargestellt, die die
sogenannte Eilgangschaltung (oder Differenzialschaltung) auch für Antriebe, die
von einer Druckquelle gespeist werden, ermöglicht.
Der für Eilvorlauf von der Druckquelle bereitzustellende Volumenstrom kann
stark reduziert werden, wenn die drei Wegeventile die in Abb. 14.5 b für EV an-
gegebene Kombination realisieren. Dann hat die Schaltung die in Abb. 14.5 c dar-
gestellte Struktur (Berechnungen in Abschn. 7.2).
Kraftantriebe. Kraftantriebe dienen zum Festhalten (Spannen) oder Verformen
von Werkstücken sowie zum Realisieren eines Gewichtsausgleichs von Lasten,
deren Bewegungsrichtung eine senkrechte Komponente besitzt. In Abb. 14.6 sind
Varianten derartiger Antriebe abgebildet. Sind die geforderten Kräfte annähernd
konstant und der Arbeitszylinder richtig dimensioniert, ist die einfache Schaltung
in Abb. 14.6 a möglich.
