Will D., Gebhardt N. (Hrsg.) Hydraulik: Grundlagen, Komponenten, Schaltungen
Подождите немного. Документ загружается.

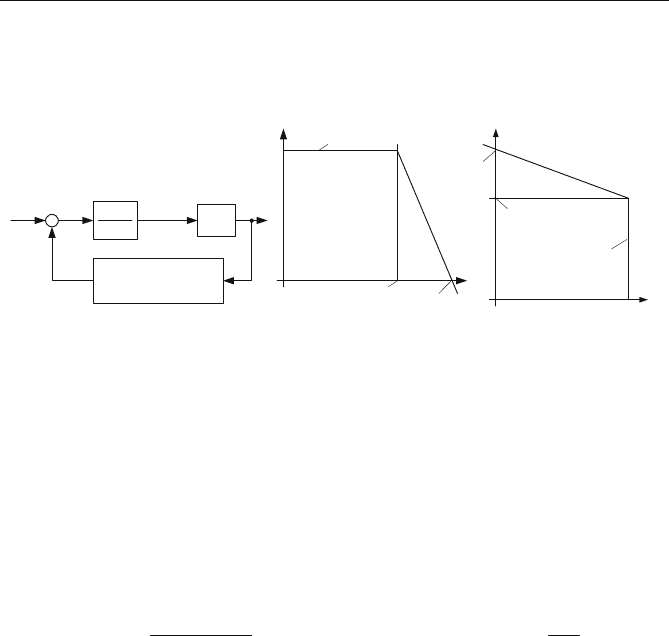
428 14 Projektierung und Gestaltung von Kreisläufen
ist. Die Federsteife, die Stellkolbenfläche und die Konstruktion der Pumpe be-
stimmen die Empfindlichkeit.
1
C
hges
dt
³
p
DQ
6
Q
Ak
Q
DQ
-
Q
gesp
dp
DQ
/dt
Pumpe mit
Stelleinrichtung
p
DQ
Q
DQ
Q
Pmax
p
EB
= F
0
/A
St
p
DQ0
p
DQ
Q
Pmax
p
DQ0
6
Q
Ak
p
EB
= F
0
/A
St
a b c
Abb. 14.13 Wirkungsweise einer Nullhubregelung mit direkt beaufschlagter Stelleinheit.
a vereinfachtes quantitatives Blockschaltbild b Kennlinie der Stellpumpe mit Stelleinrichtung al-
lein c Kennlinie der gesamten Druckregelung
6
Q
Ak
Gesamtheit aller Volumenströme zu den Antrieben, Q
DQ
von der Druckquelle bereit-
gestellter Volumenstrom, Q
gesp
gespeicherter Volumenstrom, Q
Pmax
Pumpenförderstrom bei aus-
geschwenkter Stelleinheit, p
DQ
Quellendruck, p
EB
der Druck, bei dem die Pumpe einzu-
schwenken beginnt, p
DQ0
der Druck, bei dem Q
DQ
= 0 wird, C
hges
Gesamtkapazität von
Druckleitung und Speicher, A
St
Fläche Stelleinrichtung, F
0
Federvorspannkraft der Stellein-
richtung
Mit den in Abb. 14.13 b angegebenen Größen ergibt sich die folgende Kenn-
linienfunktion:
0
0
max
DQEB
DQDQ
PDQ
pp
pp
QQ
für
0DQDQEB
ppp dd mit
St
EB
A
F
p
0
(14.1)
Im stationären Zustand der Regelung ist Q
DQ
=
6
Q
Ak
, und die Kennlinie der Rege-
lung ist exakt die reziproke Kennlinie der Pumpe mit Stelleinrichtung (vgl. Abb.
14.13 b mit Abb. 14.13 c). Dieses Regelungsprinzip erfüllt die Forderung nach ge-
ringen Eigenverlusten, da die Verstellpumpe mit Hilfe der Regelung nur so viel
fördert, wie vom Kreislauf gefordert wird.
Unter bestimmten Bedingungen kann die Über-Null-Steuerung einer Verstell-
pumpe erforderlich werden, z. B. beim Gewichtsausgleich mit einem Arbeits-
zylinder (s. Abb. 14.6 d). Dieser kann beim Nach-unten-fahren einen Volumen-
strom in den Kreislauf eintragen. Die Regelfunktion bleibt dann auch im
Nachbarquadranten erhalten (das Rückschlagventil muss entfernt werden). Die
Kennlinie endet nicht an der Ordinate, sondern schneidet sie (s. Abb. 14.13 c). Die
Pumpe befindet sich dann im Motorbetrieb und treibt ihren Antriebsmotor, der
ggf. Energie ins elektrische Netz zurückspeisen kann, an.
Die Nullhubregelung arbeitet mit oder ohne Speicher, aber ein Speichereinsatz
bringt zwei wesentliche Vorteile:
Ohne Speicher muss die Pumpe auf die maximal auftretende Volumenstrom-
anforderung ausgelegt werden. Mit Speicher kann die Pumpe ggf. so ausgelegt
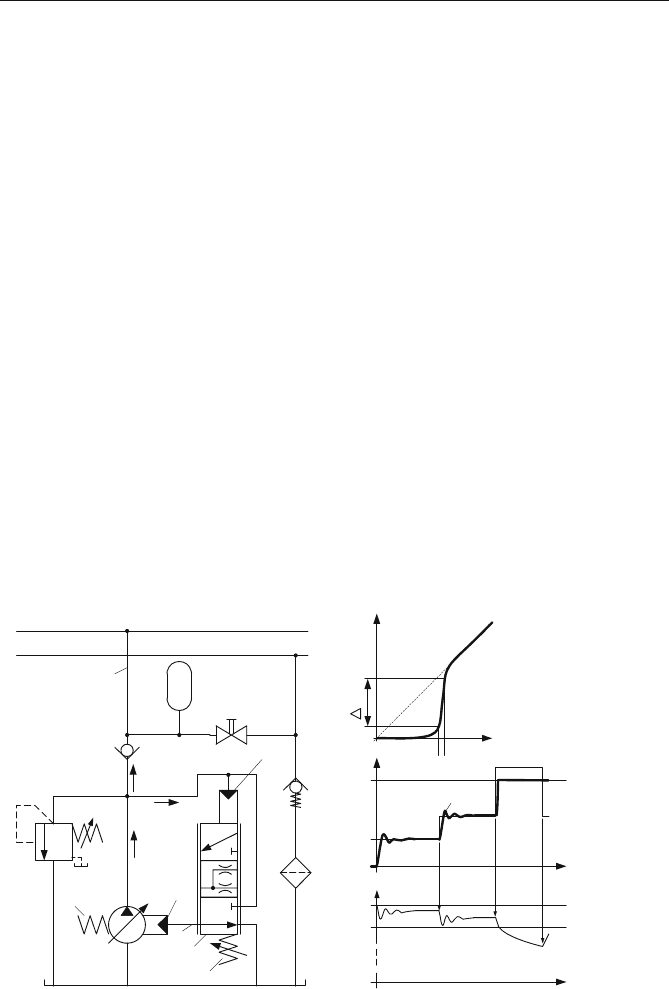
14.3 Kreisläufe mit Druckquellen konstanten Drucksollwertes 429
werden, dass die mittlere Volumenstromanforderung mit Reserve erfüllt wird.
Anforderungsspitzen deckt der Speicher ab.
Aus dem Blockschaltbild in Abb. 14.13 a ist zu ersehen, dass schnelle Ände-
rungen der Volumenstromanforderungen eines Antriebs
'
Q
Ak
bei großer Spei-
cherkapazität C
hges
nur kleine Druckänderungsgeschwindigkeiten dp
DQ
/dt (also
langsame Druckänderungen) hervorrufen. Die verzögert wirkende Stelleinrich-
tung kann dieser langsamen Druckänderung viel besser folgen und den Pum-
penförderstrom Q
P
an den veränderten Bedarf anpassen, ohne dass bereits gro-
ße Druckspitzen oder -einbrüche aufgetreten. Der Speicher sorgt damit auch
dafür, dass die Stellbewegungen relativ langsam (und damit lebensdauer-
erhöhend) bei gleichzeitig geringen dynamischen Regelfehlern ablaufen
(Abschn. 14.3.5.2).
Durch das Vorschalten günstig ausgelegter Druckteiler oder auch die Lage-
regelung des Stellkolbens kann die Kennlinie Q
DQ
= f(p
DQ
) der Stelleinrichtung
steiler und die Kennlinie der Regelung p
DQ
= f(
6
Q
Ak
) flacher gestaltet werden. In
Abb. 14.14 a ist eine Nullhubregelung mit steiler Charakteristik so dargestellt, wie
sie als Standardaggregat erworben werden könnte. Sie enthält deshalb neben den
Komponenten der Druckquelle einen Speicher, der aus den genannten Gründen
meist eingesetzt werden sollte, ein Druckbegrenzungsventil und ein Absperrventil
sowie Filter und Rückschlagventil in der Tankleitung. Das Druckbegrenzungs-
ventil ist das Sicherheitsventil der Anlage und deshalb auf einen höheren als den
maximalen Quellendruck p
DQ
eingestellt. Das Rückschlagventil in der Tankleitung
sichert, dass auch bei Stillstand der Anlage das Fluid in den Leitungen und vor al-
lem in den Antrieben bleibt.
a
P
T
p
DF
Druckfühler
Q
P
p
DQ
Q
DQ
Q
DF
c
DF
, F
0DF
c
St
, F
0St
A
DF
A
St
b
c
p
DQ
p
DF
p
DF
p
EB
p
DQ0
Q
Pmax
6
Q
Ak
Q
p
DQ
p
DQ0
p
EB
t
t
Q
DQ
(t)
Abb. 14.14 Nullhubregelung mit Druckfühler zur Realisierung einer steilen Kennlinie und mit
Speicher. a Schaltung (Druckbegrenzungsventil ist Sicherheitsventil; Absperrventil dient der
Speicherentleerung) b Kennlinie des Druckfühlers c Volumenstrom- und Druckverläufe (qualita-
tiv)

430 14 Projektierung und Gestaltung von Kreisläufen
Die Filterung im Rücklauf hat den Vorteil, Ansaugprobleme zu vermeiden (bei
geöffnetem Absperrventil kann der gesamte Behälterinhalt gefiltert werden, bevor
die Druckquelle die Antriebe versorgt). Hohe Forderungen an die Qualität der
Kennlinie werden mit Hilfe eines Druckfühlers erfüllt, dessen Kolben gegen die
vorgespannte Feder nur kleine Wege zurücklegt und der, als Druckteiler ausgelegt,
eine Leerlaufkennlinie nach Abb. 14.14 b realisiert. Wegen
'
p
DF
!! p
DQ0
- p
EB
wird der Bereich, in dem die Pumpe von Q
Pmax
auf null verstellt wird, sehr klein,
womit die erforderliche flache Regelkreiskennlinie p
DQ
= f(
6
Q
Ak
) erreicht wird (s.
Abb. 14.13 b und c). In der Stelleinrichtung können die Federvorspannung klein
und die Feder relativ steif sein, damit die meist schwer beherrschbaren inneren
Kräfte der Pumpen (sog. Rückstellkräfte) nahezu vernachlässigbar gegenüber den
Stellkräften werden. Es ist aber zu bedenken, dass Druckfühler und Stelleinheit
Feder-Masse-Systeme sind, die oft zu schwach gedämpften Übergangsvorgängen
i. d. R.ung führen. In Abb. 14.14 c sind Q
DQ
(t) und p
DQ
(t) für einen an-
genommenen Verlauf der Volumenstromanforderung
6
Q
Ak
(die zeitweise größer
ist als Q
Pmax
) qualitativ dargestellt. Druck und Volumenstrom besitzen zunächst
nach dem Abklingen der Übergangsvorgänge Werte, die der Kennlinie ent-
sprechen. Bei Überforderung der Pumpe wird p
DQ
kleiner als p
EB
, der Druck bricht
dabei umso langsamer ein, je größer der Speicher ist. Dieses Verhalten wird in
Abschn. 14.7 einer Berechnung zugänglich gemacht.
In Nullhubregelungen kann an die Stelle eines Druckfühlers auch ein elektrisch
ansteuerbares Stetigsteuerventil treten. Der Regler wird dann elektronisch (analog
oder digital) realisiert, das Drucksignal wird ihm von einem Drucksensor zur Ver-
fügung gestellt. Der Regler kann dann komfortabler strukturiert werden und weite-
re Signale verarbeiten. Von Bedeutung ist das vor allem, wenn veränderliche
Drucksollwerte zu verarbeiten sind (Abschn. 14.4).
Abschaltpumpe. Ähnlich günstige ökonomische Kennwerte besitzt die Abschalt-
pumpe (Prinzip s. Abb. 14.12 b). In dieser typischen Zweipunktregelung wird das
2/2-Wegeventil mit Hilfe von zwei in einer einfachen logischen Schaltung ver-
arbeiteten Druckschaltersignalen angesprochen. Die Zeiten zwischen den Um-
schaltvorgängen sind umso größer und die Belastung der Komponenten damit um-
so geringer, je größer die Kapazität des Leitungssystems und der angeschlossenen
Speicher ist, weshalb diese Druckquellen immer mit Druckflüssigkeitsspeichern
ausgerüstet werden. In Abb. 14.15 a ist eine mögliche Schaltung eines Aggregates
mit Abschaltpumpe dargestellt. Druckbegrenzungsventil, Absperrventil und Rück-
schlagventil sowie Filter in der Tankleitung haben dieselbe Aufgabe wie in Abb.
14.14 a. Die Pumpe wird zwischen den Zuständen Förderung in den Kreislauf und
Förderung nahezu drucklos in den Behälter hin- und hergeschaltet. Diese Druck-
quellen zeichnen sich ebenfalls dadurch aus, dass gegen den Druckquellendruck
durchschnittlich nur ein so hoher Volumenstrom gefördert wird, wie die Antriebe
fordern. Das Schalten lösen Druckschalter mit einstellbarer Hysterese aus. Die
Druckwerte p
DSo
, p
DSu
sind der obere und der untere Schaltpunkt. Erreicht p
DQ
den
oberen Schaltpunkt, wird die Pumpe auf drucklosen Umlauf geschaltet, der Druck
p
DQ
(t) sinkt ab bis auf p
DSu
, dann wird wieder zugeschaltet.
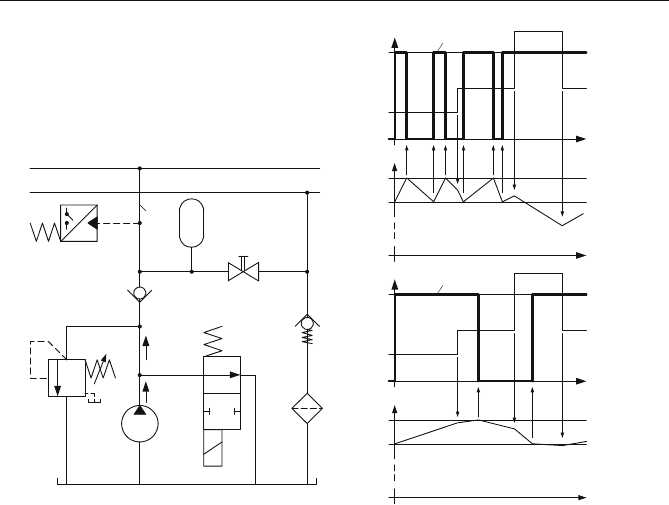
14.3 Kreisläufe mit Druckquellen konstanten Drucksollwertes 431
a
P
T
Q
DQ
p
DQ
1
2
Q
P
b
Q
P
6
Q
Ak
Q
p
DQ
p
DSo
p
DSu
t
t
Q
DQ
(t)
Q
P
6
Q
Ak
Q
p
DQ
p
DSo
p
DSu
t
t
Q
DQ
(t)
Abb. 14.15 Abschaltpumpe. a Schaltung b Volumenstrom- und Druckverläufe bei kleinem
(oben) und großem Speicher (unten)
Ist die Pumpe richtig ausgelegt, erreicht p
DQ
(t) nach entsprechender Zeit wie-
derum den Wert p
DSo
und wird wieder abgeschaltet. Solange der geforderte Volu-
menstrom kleiner als Q
P
ist, bleibt p
DQ
(t) im Bereich p
DSo
... p
DSu
; p
DQ
(t) kann aber
unter p
DSu
abfallen, wenn diese Bedingung zeitweise nicht erfüllt ist. Dann wird
das Defizit vom Speicher bereitgestellt. Um das Überschreiten zulässiger Grenzen
des Druckabfalls zu verhindern, sind in der Phase der Projektierung entsprechende
Berechnungen erforderlich (Abschn. 14.6).
Für relativ hohe Anforderungen an die Druckkonstanz müssen p
DSo
und p
DSu
eng beieinander liegen. Um trotzdem nicht zu hohe Schaltfrequenzen zu erhalten,
müssen große Speicher eingesetzt werden (vgl. hierzu die Druck- und Volumen-
stromverläufe in Abb. 14.15 b). Nicht selten werden, z. B. aus Geräuschgründen in
Hydraulikanlagen von Bühnen, die Speicher so ausgelegt, dass die Antriebe meh-
rere Stunden bei abgeschalteten Pumpen arbeiten können (Speicherbetrieb). Dann
wird i. Allg. der Antriebsmotor der Pumpe geschaltet, Abschaltventil und Druck-
schalter können entfallen. Es ist zu beachten, dass zwar ein hoher volumetrischer
Wirkungsgrad erreicht wird, dass aber infolge großer Speicher das Bauvolumen
dieser Druckquelle relativ groß ist und das Zweipunktverhalten zu großen Druck-
schwankungen führen kann.
Drehzahlveränderliche Konstantpumpe. Die Entwicklung der elektrischen An-
triebstechnik, vor allem der Umrichtertechnik für Asynchronmotoren, ermöglicht
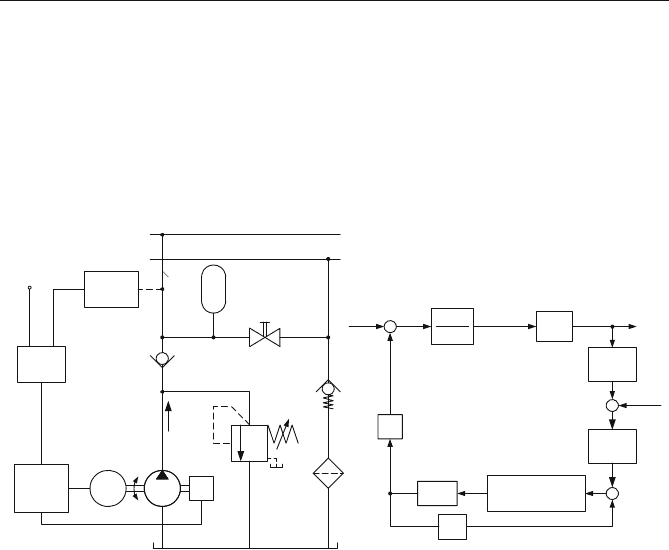
432 14 Projektierung und Gestaltung von Kreisläufen
zunehmend den wirtschaftlichen Einsatz einer von einem drehzahlveränderlichen
Motor angetriebenen Konstantpumpe als Druckquelle (Prinzip s. Abb. 14.12 c),
auch wenn die Verluste im Umrichter noch höher als z. B. in einem Druckfühler
sind. In Abb. 14.16 a ist eine Schaltung mit unterlagerter Drehzahlregelung (die
nicht unbedingt erforderlich, aber im Sinne der Dynamik der Regelung günstig ist)
dargestellt, in Abb. 14.16 b das regelungstechnische Blockschaltbild.
P
T
Q
DQ
=Q
P
p
DQ
M
TG
Druck-
sensor
Druck-
regler
i
U
pist
U
psoll
U
nsoll
(Drehzahlsollwert)
U
nist
Drehzahl-
regler und
Umrichter
1
C
hges
dt
³
p
DQ
6
Q
Ak
Q
DQ
=Q
P
-
Q
gesp
dp
DQ
/dt
Motor
u
psoll
-
Druck-
sensor
Druck-
regler
Drehzahlregler
und Umrichter
V
TG
u
pist
-
u
nsoll
u
nist
in
a b
Abb. 14.16 Druckquelle mit drehzahlveränderlicher Konstantpumpe. a Schaltung b Blockschalt-
bild
M elektrischer Antriebsmotor der Pumpe, TG Tachogenerator, n Drehzahl, i Strom, u Spannung
Speicher, Druckbegrenzungsventil, Absperrventil und Rückschlagventil sowie
Filter in der Tankleitung haben dieselbe Aufgabe wie in Abb. 14.14 a. Der Druck-
regler gibt den Sollwert der Drehzahl, die den Volumenstrom der Pumpe be-
stimmt, als Stellgröße aus. Diese Druckquelle ist ebenfalls eine stetige Druck-
regelung, weshalb Kennlinienpunkte analog der Nullhubregelung angefahren
werden können. Im Gegensatz zur Nullhubregeleinrichtung muss der Druckregler
aber kein P-Regler, sondern er kann ein PI-Regler sein. Der integrierende Anteil
dieses Reglers hat den Effekt, dass sich die Regelung immer bei u
pist
= u
psoll
aus-
regelt, also auch bei p
DQ
= p
DQsoll
= konst.
Konstantpumpe mit Druckbegrenzungsventil. Eine Konstantpumpe mit Druck-
begrenzungsventil (Abb. 14.12 d) erfüllt die technischen Anforderungen i. Allg.
einfach und sicher. Die Einstellbarkeit von Q
DQ
wird erreicht, indem der nicht be-
nötigte Volumenstrom Q
P
|
konst. der Konstantpumpe über das Druck-
begrenzungsventil (Q
VD
) abgeleitet wird. Das Regelverhalten ist dem der
Nullhubregelung ähnlich. Der Regelbereich wird ebenfalls über die Federvor-
spannung eingestellt; das Feder-Masse-System ist aber kleiner, die Regelung

14.3 Kreisläufe mit Druckquellen konstanten Drucksollwertes 433
schneller. Ein Speicher hat dieselben Aufgaben wie bei der Nullhubregelung.
Während aber die Verstellpumpe in der Nullhubregelung nur so viel fördert, wie
die Antriebe aktuell fordern, fördert die Konstantpumpe ständig ihren unveränder-
baren Volumenstrom Q
P
gegen den Quellendruck p
DQ
. Der Volumenstromüber-
schuss wird über das Druckbegrenzungsventil unter Wärmeentwicklung ab-
geleitet. Ein einfaches Rechenbeispiel verdeutlicht die möglichen großen
Eigenverluste der Druckquelle. Sind der Volumenstrom der Pumpe Q
P
= 15 l/min
und p
DQ
= 200 bar, so entsteht bei abgeschalteten Antrieben (Q
DQ
= 0, Q
VD
= Q
P
)
allein im Druckbegrenzungsventil eine Wärme- und damit Verlustleistung P
Verl
=
Q
P
p
DQ
= 3000 bar
l/min = 5 kW. Eine Verringerung dieser Leistungsverluste
wird erreicht, wenn mehrere Konstantpumpen mit fremd- und eigengesteuerten
Druckbegrenzungsventilen zu einer Druckquelle nach Abb. 8.8 d zusammen-
geschaltet werden. Die maximal auftretenden Drosselverluste werden von der
größten Pumpe bestimmt, sie sind Q
Pmax
p
DQ
. Beachtet werden muss zusätzlich
die Stufung der Kennlinie p
DQ
= f(
6
Q
Ak
).
In Tabelle 14.3 sind die Aussagen zu den beschriebenen vier Druckquellen-
varianten zusammengefasst.
Tabelle 14.3 Qualitativer technisch-ökonomischer Vergleich einfacher Druckquellen
Druckquelle Art der
Regelung
Kennlinie der Rege-
lung p
DQ
= f(
6
Q
Ak
)
Dyn. Druck-
schwankg.
Preis Eigen-
verluste
Nullhubregelung stetig flach gering mit
Speicher
hoch gering
Abschaltpumpe Zweipkt.-
Regelung
existiert nicht ständiges
Schwanken
ge-
ring
gering
Drehzahlveränderl.
Konst.-Pumpe
stetig kann sehr flach sein gering mit
Speicher
hoch durch E-
Antrieb
Konst.-Pumpe(n)
mit Druckbegr.-
Ventil(en)
stetig, ggf.
mehrere
Bereiche
flach oder gestuft sehr gering ge-
ring
hoch
14.3.4 Leitungssystem
Bei der Gestaltung des Leitungssystems sollte Folgendes beachtet werden:
Die Lage der Verbraucher wird von der Gesamtanlage bestimmt, sie ist damit
vorgegeben.
Die Antriebssteuerungen sind möglichst nahe den Verbrauchern anzuordnen,
um zwischen Verbraucher und Steuerung große Volumina der Hydraulik-
flüssigkeit, die zu verminderter Antriebssteifigkeit führen, zu vermeiden (s.
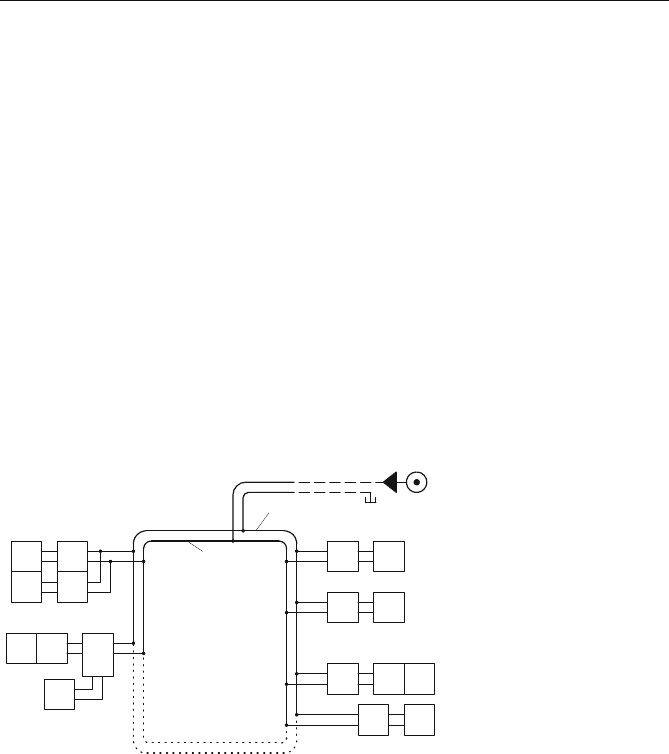
434 14 Projektierung und Gestaltung von Kreisläufen
Abschn. 14.3.5). Aus Gründen einfacher Wartungs- und Einstellarbeiten ist ei-
ne gruppenweise Anordnung der Steuerventile in der Nähe der entsprechenden
Gruppe von Verbrauchern oft die günstigste Lösung.
In stationären Hydraulikkreisläufen kann die Druckquelle relativ weit entfernt
von der übrigen Anlage aufgestellt sein. Dann sind die Wärme- und vor allem
die Geräuschbelästigung der Bediener der Anlage geringer. Das dann größere
Leitungsvolumen hat auf die Antriebsdynamik und auf die Antriebssteife kei-
nen Einfluss. Die Zusatzkosten sind dadurch nicht sehr hoch, dass nur zwei
oder drei Leitungen (wenn eine gesonderte Leckleitung erforderlich ist) das
Aggregat (mit der Druckquelle) und die restliche Anlage verbinden.
Abbildung 14.17 zeigt eine Möglichkeit günstiger Leitungsführung unter Be-
achtung dieser Prämissen (eine gesonderte Leckleitung sei nicht erforderlich). Die
gepunktet gezeichnete Verbindung der Leitungen P und T zu Ringleitungen hat
zwei Vorteile: zum einen kann ein Antrieb mit hoher Volumenstromanforderung
auf zwei Wegen versorgt werden, zum anderen werden Druckwanderwellen, die
beim Beschleunigen und Abbremsen der Fluidsäulen entstehen, nicht total reflek-
tiert [14.4, 14.8].
St
V
V
V
St
St
St
V
V
VV
V
St
St
St
P
V
V
T
V
St
DQ
P
T
Verbraucher,
Steuerung,
Druckquelle,
Druckleitung,
Tankleitung
Abb. 14.17 Eine Möglichkeit günstiger Leitungsführung in einer Anlage mit Druckquelle
14.3.5 Dynamisches Verhalten
14.3.5.1 Das Verhalten der Antriebe
In Abb. 14.2 sind wesentliche Kopplungen in Kreisläufen mit Druckquelle dar-
gestellt. Die gegenseitige Beeinflussung von Antrieben kann nur verhindert
werden, wenn die Druckregelung und das Leitungssystem so ausgelegt sind, dass
statisch und dynamisch keine unzulässig großen Druckschwankungen entstehen
können. Ein Antrieb an einer Druckquelle ist unter mehreren Aspekten zu be-
trachten:
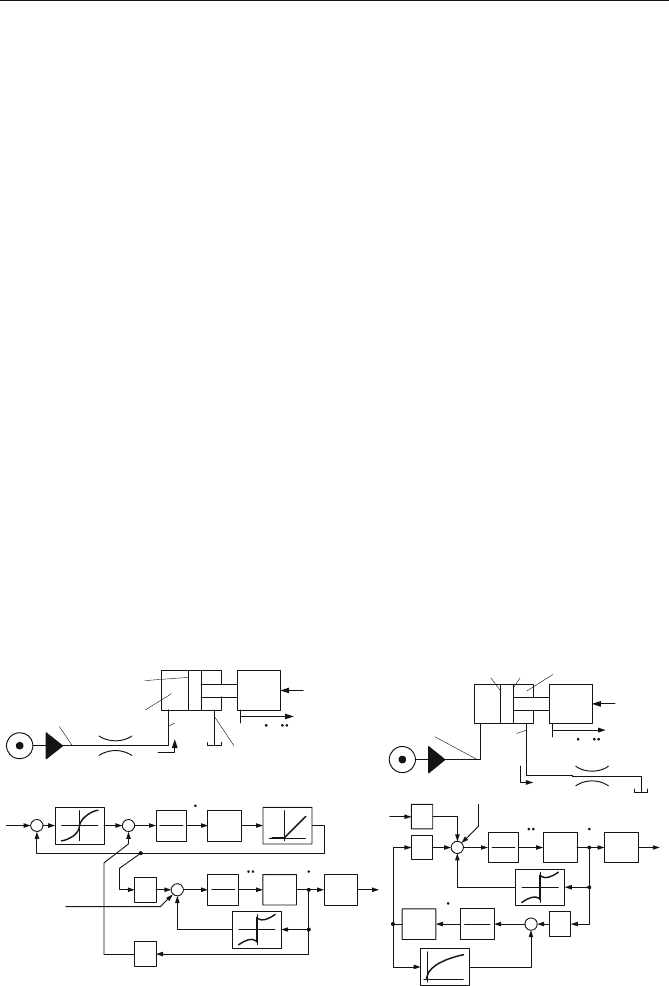
14.3 Kreisläufe mit Druckquellen konstanten Drucksollwertes 435
Der Antrieb ist Bestandteil der Druckregelstrecke, er ist Teil des Gesamtwider-
standes der Antriebe (s. Abschn. 14.3.5.2).
Eine Änderung seines Volumenstrombedarfs ist Störgröße der Druckregelung.
Dabei verursacht das Schalten von Wegeventilen näherungsweise sprung-
förmige Änderungen des Volumenstromes.
Mit welcher Verzögerung reagiert die Ausgangsgröße Position, Geschwindig-
keit/Drehzahl oder Kraft/Moment auf ein Steuersignal? Wie stark und mit wel-
cher Verzögerung beeinflusst ein Schwanken der Belastungskraft F
L
oder des
Druckes p
DQ
der Druckquelle das Verhalten des Antriebes? Dieser Aspekt wird
im Folgenden näher untersucht.
Wegeventilgesteuerte Antriebe. In Abb. 14.18 a und b sind typische wegeventil-
gesteuerte Antriebsstrukturen während der Übergangsvorgänge Anlauf oder Um-
steuern dargestellt.
Sie sind aufgeteilt in Zulaufdrosselung und Ablaufdrosselung mit Drosselventil
(die Wegeventile sind in den Strukturen nicht enthalten, da sie geschaltet sind und
die entsprechenden Wege damit festgelegt haben). Die Modellermittlung erfolgte
in den in Abschn. 4.9 beschriebenen Schritten [14.19]. Die Beschreibung des
Drosselventils wird gemäß Tabelle 4.6 vorgenommen. Die Nichtlinearität, die ein
Absinken des Druckes p
1
auf negative Werte im Modell in Abb. 14.18 c
verhindert, ist in den Abschn. 4.1 und 4.9 beschrieben.
Beide Modelle wurden für Anlauf mit Hilfe einer geeigneten Software [14.9]
bei typischerweise geringer Dämpfung und bei geringer Gegenkraft F
L
simuliert.
Die Ergebnisse bei Drosselung des Zulaufs und bei Drosselung des Ablaufs sind
in Abb. 14.19 dargestellt (die verwendeten Parameter sind angegeben, die
Reibkraft wurde geschwindigkeitsproportional angesetzt).
p
DQ
m
s, s, s
V
1
p
2
= 0
Q
1
A
1
p
1
F
L
a b
p
DQ
= p
1
m
s, s, s
V
2
A
2
p
2
Q
2
A
1
F
L
dt
³
1
V
1
ß
-
p
DQ
p
1
p
1
Q
1
Q
g1
-
A
1
dt
³
1
m
dt
³
A
1
sss
-
-
F
B
F
R
F
L
c d
A
1
dt
³
1
m
dt
³
A
2
A
2
sss
dt
³
1
V
2
ß
-
-
-
p
DQ
p
2
p
2
F
B
F
R
Q
2
Q
g2
-
F
L
Abb. 14.18 Antriebsstrukturen für Übergangsvorgänge. a zulaufseitige Drosselung des Ver-
braucherstromes b ablaufseitige Drosselung c Blockschaltbild bei Zulaufdrosselung
d Blockschaltbild bei Ablaufdrosselung
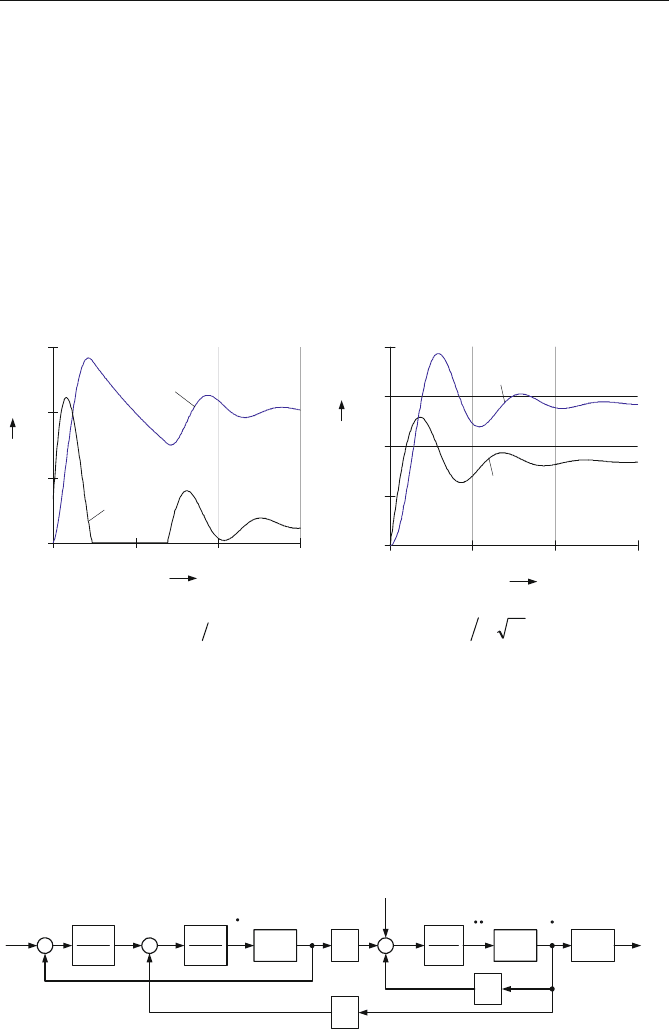
436 14 Projektierung und Gestaltung von Kreisläufen
An den Druckverläufen sind die Unterschiede beider Strukturen zu erkennen.
Die Zulaufdrosselung ist vor allem bei kleinen Gegenkräften zu vermeiden, um
zeitweiliges Zusammenbrechen des Druckes p
1
und damit Kavitation zu
vermeiden.
Bei Ablaufdrosselung ist der Druck p
2
relativ hoch, da sich der Arbeitszylinder
zwischen Druckquelle und Stromventil befindet und zusätzlich eine Drucküber-
setzung infolge A
1
> A
2
entsteht.
In den zwei simulierten Fällen entsteht Überschwingen (das bei schaltenden
Wegeventilen nicht zu vermeiden ist). Als Periodendauerwerte T
P
sind T
P
| 90 ms
in Abb. 14.19 a und T
P
| 115 ms in Abb. 14.19 b zu ermitteln. Diese Zusam-
menhänge werden im Folgenden untersucht.
0
30
60
90
0 0,1 0,2 0,3
v(t)
bar
mm/s
p,v
t
s
p
1
(t)
a
p,v
0
40
80
120
160
0 0,1 0,2 0,3
t
s
v(t)
p
2
(t)
bar
mm/s
b
NFNsmmAkdtdsmmNsFbarp
L
Dr
Dr
R
DQ
20020000/)10(100
4
kgmmm³VVNmmmmAmmA 200010108001000
5
21
1232
2
2
1
|
E
Abb. 14.19 Druck- und Geschwindigkeitsverläufe. a Druck p
1
und Geschwindigkeit v (= ds/dt)
bei zulaufseitiger Drosselung b p
2
und v bei ablaufseitiger Drosselung (p
1
= p
DQ
)
Die dynamischen Kennwerte können mit Hilfe typischer Übertragungs-
funktionen, die jedoch nur für lineare Verhältnisse aufstellbar sind, errechnet
werden (s. Abschn. 4.10). In Abb. 14.20 ist das aus Abb. 14.18 c abgeleitete
linearisierte Blockschaltbild dargestellt (s. auch Abschn. 4.10).
dt
³
1
m
dt
³
A
1
A
1
sss
dt
³
1
V
1
ß
1
R
h
-
-
-
p
DQ
p
1
p
1
F
B
F
R
Q
1
Q
g1
F
L
-
k
Abb. 14.20 Linearisiertes Blockschaltbild bei zulaufseitiger Drosselung eines Verbraucher-
stromes mit einem Drosselventil
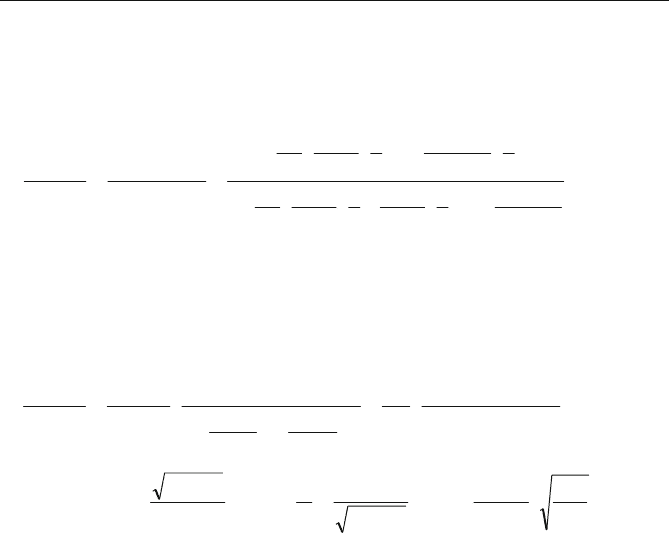
14.3 Kreisläufe mit Druckquellen konstanten Drucksollwertes 437
Das Drosselventil wird als linearer hydraulischer Widerstand R
h
=
'
p/Q
1
be-
schrieben. Die Reibkraft F
R
sei ebenfalls linear beschreibbar: F
R
= k ds/dt. Die
Übertragungsfunktion s(s)/p
DQ
(s) errechnet sich über die allgemeine Wirkungs-
kreisformel in Gl. (14.2) zunächst zu (beachte: die Integration wird zu 1/s):
ksm
A
sVsVR
sksm
A
sVR
sG
sG
sp
ss
h
h
Kreis
Vorw
DQ
111111
1
11111
)(1
)(
)(
)(
2
1
11
1
1
EE
E
.
(14.2)
In hydraulischen Antrieben mit Drosselventilen kann meist ohne großen Fehler die
geschwindigkeitsproportionale Komponente der Reibkraft vernachlässigt werden
(k
| 0), da der hydraulische Widerstand R
h
bei der Geschwindigkeitsbegrenzung
dominiert. Die Übertragungsfunktion in Normalform lautet (alle Parameter sind
Zeitkonstanten oder Potenzen von Zeitkonstanten):
22
2
2
1
1
2
1
1
21
1
1
11
)(
)(
sTsDT
s
K
s
A
mV
s
AR
m
ARssp
ss
I
h
hDQ
E
mit
1
1
A
Vm
T
E
,
E
Z
1
1
1
Vm
A
T
e
,
E
11
2
1
V
m
AR
D
h
.
(14.3)
Die Kennwerte Eigenzeitkonstante T, Eigenkreisfrequenz
Z
e
, (sie ist die reziproke
Eigenzeitkonstante T) und Dämpfung D können relativ leicht errechnet werden.
Der das dynamische Verhalten am deutlichsten kennzeichnende Parameter ist die
Eigenzeitkonstante T (bzw. Eigenkreisfrequenz
Z
e
, = 1/T). Je größer A
1
ist, desto
schneller reagiert der Antrieb, je größer die zu bewegende Masse m (liegt i. Allg.
fest) und das komprimierbare Volumen V
1
(bestehend aus Zylinder- und
Leitungsvolumen) sind, desto langsamer reagiert der Antrieb. Vor allem deshalb
ist nahes Anordnen des Steuerventils am Verbraucher anzustreben. Ein weiterer
Aspekt ist wichtig: Da V
1
sich annähernd proportional mit A
1
ändert (s. Abb.
14.18 a), V
1
aber nur mit der Wurzel in T eingeht, verringert sich die Eigenzeit-
konstante T mit wachsendem A
1
trotz gleichzeitig wachsenden Volumens V
1
. Ein
kleinerer Verbraucher verringert demnach die Reaktionsschnelligkeit eines An-
triebs. Weitere Übertragungsfunktionen zwischen den Eingangsgrößen p
DQ
-, F
L
-
oder R
h
-Änderung und den Ausgangsgrößen s, ds/dt oder Q
1
besitzen dieselben
Parameter der Verzögerung, aber das Grundverhalten ändert sich.
Sehr geringen (oft vernachlässigbaren) Einfluss auf die stationäre Ge-
schwindigkeit haben Druck- und Belastungskraftänderungen, wenn an die Stelle
des Drosselventils ein Zwei-Wege-Stromregelventil tritt (s. Abschn. 8.2.2). Aber
das dynamische Verhalten wird infolge der Kolbenbewegung des Druckdifferenz-
ventils im Stromregelventil beeinflusst. Es entsteht eine zusätzliche hydraulische
Kapazität C
hVD
aus Kolbenfläche A
VD
und Federkonstante c
VD
des Druckdifferenz-
